Hier werden nach und nach sämtliche Bildbesprechungen bereitgestellt, die Radjo Monk vor allem in den 1990er Jahren anläßlich von Ausstellungseröffnungen für Edith Tar verfaßt hat. Es handelt sich hier meist um einen Mix aus moderierten Hintergrundinformationen
zur Bildgenese und Bildinterpretationen, die den jeweiligen Ausstellungsanlaß fokussieren.
Europa? Willkommen in der autre monde
Als wir uns 1992 auf eine Entdeckung Europas einließen, spürten wir bald, daß diese Entdeckung einem langen Abschied von Europa gleichkommt.
Bislang haben wir Irland, England, Polen, Ungarn, Tschechei, Israel, Griechenland Südfrankreich bereist, um Material zu sammeln - und natürlich auch immer wieder Deutschland. Diese Reisen wurden für uns zu einem geistigen Weitwinkelobjektiv, das unseren Blick auf Europa prägt.
Europa wächst aus Nationen, die sich über kriegerische Konflikte ausgebildet haben. Das heute angestrebte Europa gab es aber bereits in Ansätzen in der Blütezeit des Feudalismus, als den Europäern das christliche Hemd näher war als die monastische Jacke, am ausgeprägtesten wohl zur Zeit Kaiser Karl V. Die Grenzen des heutigen Europa sind eine Folge des Zweiten Weltkrieges. Es sind Grenzen, die abgebaut werden, um sich an anderer Stelle neu zu formen.
Europäische Identität – was ist das, was könnte das sein? Dampfmaschine, Elektrizität, Mozart, Kolonien, Relativitätstheorie, Templer, Burgen, große Schlachten? Königshäuser, die noch nach Beginn des vergangenen Jahrhunderts Könige Repräsentanten nationaler Identität waren und in manchen Ländern noch immer diese Rolle spielen?
Wenn es so etwas wie europäische Identität gibt, dann speist sie sich aus den Tiefen der europäischen Geschichte, und das setzt natürlich eine Beschäftigung mit derselben voraus.
Die derzeit um den Europabegriff kreisenden Fragen werden gern in Pro und Kontra zerlegt. Uns geht es hier nicht um ein Fürundwider, sondern um die Wurzeln Europas.
Wir halten alle Fragen für berechtigt, denn jede Frage hilft, eine Antwort zu finden. Und wenn jede Antwort neue Fragen aufwirft, muß das nicht zu Nervosität oder Ratlosigkeit führen, sondern kann zum Ausdruck für ein gereiftes Bewußtsein werden, das europäische Entwicklung als etwas Lebendiges begreift, das sich von Fragen ernährt.
In Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ ist das Fragenkönnen ein zentrales Motiv, von dem das gesamte Handlungsgefüge abhängt: Parzivals Abenteuer beginnen erst richtig in dem Moment, als er die entscheidende Frage nicht stellt. Was er danach erlebt und erleidet, erscheint als ein Reifeprozeß, durch den er fähig wird, die richtige Frage im richtigen Augenblick zu stellen.
Es handelt sich um eine schlichte, rein menschliche Frage, die Parzival stellen muß: „Was fehlt dir?“, fragt er am Ende den kranken Gralskönig, und erst durch diese mitfühlende Frage kommt die Geschichte an ein gutes Ende.
Hätte Parzival nach dem Architekten der Gralsburg gefragt, es hätte niemandem genutzt.
In diesem Sinne fragen wir in unserer Arbeit nicht nach der Funktion, sondern nach dem Bezug. Es ist eine künstlerische Arbeit, die eingebunden bleibt in die Gegenwart.
Die Europadiskussion wird beherrscht von Fragen, die auf Wirtschaft und Politik zielen und für den Einzelnen oft in Abstraktionen versanden. Wie wird Europa sein, wenn die Grenzen zwischen den Ländern nur noch nominale sind, wenn wirtschaftliche Anpassung regionale Identität übertüncht und ausdünnt, wenn Kulturbegriffe zur Massenware werden? Wird Europa ein Großkonzern, der die abendländische Kultur als Bonus benutzt, um seine Produkte auf dem Weltmarkt besser verkaufen zu können?
Es kann nützlich sein, die Fragen mit Gegenfragen zu kontern, um einen gedanklichen Rahmen zu schaffen. Die Frage: was kommt, wenn „Europa kommt“? klingt ganz anders, wenn gleichzeitig gefragt wird: woher kommt denn Europa?
Die „Euroskeptiker“ haben recht: Europa verschwindet täglich ein bißchen mehr.... Und die „Eurobefürworter“ haben auch recht, wenn sie Europa am Horizont neu aufscheinen sehen.
Eine andere Frage, die ebenso oft gestellt wird wie die obige, lautet: „Wohin geht Europa?“ Die Frage, wenn sie nicht bloß rhetorisch gestellt wird, vibriert vor Ungewißheit. Fragen von solcher Komplexität zu beantworten, bleibt erfahrungsgemäß dem Leben selbst vorbehalten, weshalb sich dieser Text auf die Betrachtung der künstlerischen Arbeit beschränken soll, um die es ja hier letztlich geht. Da es Ziel dieser Arbeit ist, eigene „Europaerfahrungen“ vor dem Hintergrund der Gralsepen zu formulieren, ist die Befragung der Geschichte notwendig.
Unter Historikern mag die Frage „was wäre geschehen, wenn...“ (beispielsweise Cäsar nicht ermordet oder während des Ersten Weltkrieges Hitler als Meldegänger von jenem britischen Soldaten, der ihn wehrlos vor dem Karabiner hatte, erschossen worden wäre) verpönt sein. Diese Frage zu stellen, und die Antworten zu durchdenken, führt in ein virtuelles Labyrinth der Spekulationen, die gar nicht müßig sind, denn in diesem Labyrinth entdeckt man irgendwann, daß es zwar aus den endgültigen Momenten der Geschichte besteht, daß aber Geschichte nicht mehr und nicht weniger final ist als jeder Augenblick und erst dann „geschieht“, wenn genügend Augenblicke zu Dämmen der Taten- und Gedankenlosigkeit aufgehäuft worden sind. Geschichte ist fortwährende Wandlung, eine Permutation von sich stets an den Betrachter anpassenden Mustern.
Wenn ein Mensch in seinem Leben eine Wandlung erfährt, geschieht diese nur sehr selten allmählich, sondern meist sprunghaft und verbunden mit schockähnlichen Zuständen, in denen die Zeit als aufgehoben empfunden wird - die Gegenwart wird zur Totale, taucht das Vergangene in ein Licht, das ihm völlig unbekannte Eigenschaften abgewinnt, und macht die Zukunft zu einem durchscheinenden Jetzt.
Das ist „der Gral - ein mentaler Trafo“, wie wir ihn 1997 in der gleichnamigen Installation dargestellt haben (Oktober 1997 in Leipzig, Aula der Alten Nikolaischule; April 1998 im Bürgerfoyer des Landtages Dresden).
Um die Arbeit „Wurzeln Europas/Der Gral transparent zu machen, ist vorab ein kurzer historischer Abriß nützlich.
Die Gralsromane des 12. Jh. stehen am Beginn der Moderne, als die wir unsere Zeit bezeichnen.
Die Frage nach den Wurzeln Europas mit dem Gral zu verbinden erscheint legitim, denn keine andere Quelle der Moderne birgt soviel Hinweise auf die Schichten, die das entspringende Wasser gefiltert haben.
In den Gralsepen werden die vorchristlichen Traditionen des gälischen Kulturraumes mit spätantiken Lebensformen verschmolzen und in das christliche Glaubensbild eingepaßt.
Nach Inhalt und Gestaltung lassen sich die Gralsromane in zwei Hauptgruppen gliedern: da ist zum einen der Artusstoff, der die Frage der idealen Gesellschaft zwischen Anspruch und Scheitern behandelt, und da sind zum anderen jene Stoffe, die sich rings um den Gral als autonome Institution mit eigenen Qualitäten gruppieren. Diese Stoffe, zu denen der „Parzival“ gehört, bilden unsere Bezugspunkte, denn hier ist es der Einzelne, der die Muster einer Gemeinschaft (Artusrunde) paradoxerweise durchbricht, weil er ihren Idealen folgt.
Keiner der in der Tafelrunde organisierten Ritter findet den Gral, sondern ein Narr, der das Narrentum hinter dem Regelwerk seiner Zeit erlebt und erleidet, eben weil er es ernst nimmt.
Der Narr heißt „Parzival“: „Der Name ist so recht mittendurch“, läßt Eschenbach Sigûne sagen. Parzival, der „reine Tor“, wird am Ende nicht Berater oder gar Nachfolger König Artus, sondern Gralskönig, d.h. er wird zum ersten Diener dieser geheimnisvollen Instanz.
Die Gralsepen reflektieren nicht nur eine Zeit, in der sich das heutige Europa zu formen begann, sie stecken auch voller Parabeln auf Grundmuster menschlicher Entwicklung.
Die heutige Europaidee, deren Kern in der Verschmelzung von in Jahrhunderten gewachsenen Nationalstaaten zu einer Union besteht, ist nicht neu: im Mittelalter war diese Idee ein Ideal, das als Verwandlung antiker bzw. spätrömischer Staatsformen angesehen werden kann.
Professoren, die zur Zeit Kaiser Barbarossas in Bologna römisches Recht lehrten, vermittelten ihren Studenten, daß der Kaiser, der seine Krone aus den Händen des Papstes empfangen hat, Erbe und Nachfolger der antiken Kaiser ist.
Europa formt sich im 6. Jh. aus den Trümmern des weströmischen Reiches und wird zunächst von Germanenstämmen beherrscht, nachdem Odovacar 476 den letzten römischen Kaiser abgesetzt hat.
711 besiegt ein arabisches Heer die Westgoten, unterwirft die iberische Halbinsel und dringt weiter nach Norden vor. Für den Widerstand der Christenheit gegen den vorrückenden Islam steht ein Mann, der zum Stammvater der Karolinger werden sollte: Karl Martell (717-741),
der als Hausmeier der Merowinger 732 bei Poitiers einen entscheidenden Sieg gegen die Araber errang. Dieser Sieg wurde zum Grundstein für die Erhebung seines Sohnes Pippin (741-768) zum König der Franken im Jahr 751.
Etwa um diese Zeit begannen Mönche die mündlich tradierten Überlieferungen im gälischen Sprachraum aufzuschreiben - natürlich nutzen sie dies auch als Gelegenheit, heidnische Legenden in christliche umzuschmelzen. Der vorchristliche Hintergrund keltischer Kultur blieb auf diese Weise bis heute erkennbar. Viele der Mönche kamen aus irischen, schottischen, walisischen oder bretonischen Adelsfamilien und waren Träger druidischer Traditionen.
Die Gralsepen sind letztlich auch Ausdruck des Aufgehens keltischer Religion in der christlichen. Es waren Mönche aus Irland und Schottland, die nach der Völkerwanderung in Mitteleuropa das Christentum wiederbelebten. Sie gründeten Abteien, die zu Zentren der Kultur und der Wissensvermittlung wurden. Um manche dieser Gründungen wuchsen später die ersten Städte: Salzburg, Wien und Würzburg zum Beispiel, um nur drei zu erwähnen.
Der Einfluß dieser meist als iro-schottisch bezeichneten Mönche blieb auch nach der Synode von Whitby im Jahre 666 dominant, als die Kirchen von Irland und Schottland ihre Autonomie verloren. Das sollte sich erst in der Zeit Karl des Großen ändern, als der römische Klerus seine Macht gefestigt hatte.
Pippins Sohn Karl erweiterte das Herrschaftsgebiet der Franken in einem Maße, daß man von der Wiedergeburt des weströmischen Reiches sprechen kann. Die Wiedergeburt des weströmischen Kaisertums, das 476 erloschen war, ist historisch auf den Tag genau zu bestimmen: am Weihnachtstag des Jahres 800 setzte der Papst in Rom einem völlig überraschten Karl die Kaiserkrone auf das Haupt.
Karl der Große wurde schon zu Lebzeiten als „Vater Europas“ bezeichnet, aber innerer Streit (das Reich wurde nach altem Brauch unter den Söhnen geteilt) und schwächende Kriege mit äußeren Feinden führten im November 887 zur endgültigen Auflösung des fränkischen Reiches. Mit der Auflösung dieses Reiches zeichnen sich bereits deutlich die späteren Grenzen der europäischen Staaten ab.
Karl der Große hatte eine Reichsidee neu gepflanzt, die von nun ab politische Realität blieb, wenn auch geprägt von gravierenden Wechselfällen. Deutsche Könige und Kaiser der nachkarolingischen Ära versuchten immer wieder eine bewußte Anknüpfung an die Herrschaftstradition Karl des Großen, so auch der Sachsenkönig Heinrich I. (919-936) und sein Sohn Otto I. (936-973). Mit der Kaiserkrönung Otto I. 962 in Rom beginnt eigentlich das „Heilige Römische Reich“, das erst im 15 Jh. mit dem einschränkenden Zusatz „Deutscher Nation“ versehen wurde und bis zur Auflösung im Jahre 1806 bestand.
Die Idee vom „Universalreich“, repräsentiert durch einen priesterlich geweihten Herrscher, spiegelt sich in den Artusromanen wieder. Die Tafelrunde ist zwar in Eschenbachs „Parzival“ der gesellschaftliche Mittelpunkt der Handlung; herausgestellt aber werden die Erfahrungen, die Parzival macht. Die Gültigkeit des Epos wird bewahrt durch die Art, wie diese Erfahrungen geschildert werden. Der künstlerische Ansatz unserer Arbeit zielt genau darauf: individuelle Erfahrungen auf eine bestimmte Art mitzuteilen.
Als die Gralsepen geschrieben wurden, gab es nur eine Welt: die christliche, deren Selbst-verständnis ahnbar wird, wenn man beispielsweise die in jener Zeit gemalte „Ebstorfer Weltkarte“ betrachtet: die Karte ist nach Osten ausgerichtet und zeigt Jerusalem als Mittelpunkt nicht nur der Welt, sondern auch des Geschehens in dieser Welt, das im Einklang mit der Heilsgeschichte verstanden wurde. Daraus jedoch zu folgern, die Welt sei im 12. Jh. einfacher und überschaubarer als unsere heutige gewesen, wäre kurzsichtig.
Eschenbachs „Parzival“ steckt voller Sinnfragen, die sich aus der Kollision individueller Erfahrungen mit einem Wertesystem ergibt, das von der Gesellschaft als verbindlich betrachtet wird.
Heute sehen sich Europas Nationen gezwungen, ihre Binnenstrukturen ökonomisch und politisch einer globalisierten Wirtschaft anzupassen, für die sie nur noch partiell tonangebend sind.
Der wirtschaftliche Trend führt zu einem politischen Pragmatismus, der alte Feindbilder aus dem Konfliktregister streicht und die demokratisch-parlamentarische Basis der Entscheidungsfindung zum verbindlichen Konsens macht. Die politische Neuorientierung hängt wesentlich mit den Ereignissen im Herbst ‘89 zusammen, die uns in Leipzig besonders nahegingen. Als der Ostblock in Folge dieser Ereignisse auseinanderbrach und demokratische Reformen eine Chance bekamen, war das auch das Ende der Nachkriegsordnung.
Parallel zu dieser politischen Entwicklung nach ‘89 macht sich in Europa einerseits Regionalisierung breit, andererseits treibt eine gewisser „Eurozentrismus“ Blüten.
In den Jahrhunderten, die diesem Zwanzigsten vorausgingen, gab es den heutigen Europabegriff nicht, aber alles, was Europa ausmachte, fand seinen Ausdruck unter dem Dach des „christlichen Abendlandes“ im Handel mit Produkten, die heute als Zeugnisse einer hochentwickelten Kultur gelten: Glas aus Venedig, Stoffe aus Lyon, Porzellan aus Meißen.... die Liste der Orte und ihrer Traditionen ist lang.
Wirtschaftliche Entwicklungen und die damit einhergehenden kulturellen Impulse sind eng verzahnt mit geistigen Aufbrüchen, die sich in der Kunst widerspiegeln.
Diese Widerspiegelungen sind wie Fenster und Türen in einem europäischen Gebäude, das beständig umgebaut wird. Eine Orientierung in dieser sich ständig verändernden Konstruktion war für einen Menschen, der in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges aufwuchs, genauso schwierig wie für einen, der sich im beginnenden Industriezeitalter mit seelischer Verödung auseinandersetze, man denke nur an den „Simplicissimus“ von Grimmelshausen und an die Dichtung „Das wüste Land“ von T.S. Eliot.
Orientierungsversuche solcher Art wurden zu Räumen und verbindlichen Treppen innerhalb des kulturellen Gebäudes Europa. Wie wollte man sich heute in bestimmten Geschichtsräumen ohne die geistige Begleitung durch Hölderlin, Goethe oder Heine, durch Verlaine, Baudelaire oder Rolland zurechtfinden?
Sie waren Suchende, und die Wege, die sie gingen, wurden zum Raum. Und man sollte sich nicht täuschen durch das gegenwärtig in diese Räume fallende Licht - es kann morgen ein ganz anderes sein.
Raum wurden diese Resultate der Orientierung und Suche nur, weil Menschen es wagten, ein ungewisses Außen in ihrem inneren Selbst zu erforschen; weil sie verläßliche Muster
verließen und weil sie, ihr Verlassen-Sein ertragend, aufbrachen in andere Welten.
Aufbruch, Wagnis, Suche sind signifikante Größen im europäischen Geistesleben, deren erstes literarisches Zeugnis in der Trilogie des Wolfram von Eschenbach überliefert ist: „Parzival“, „Willehalm“ und „Titurel“.
Eschenbachs Dichtung steht am Anfang der deutschen Literatur und wird oft als Pendant zu einem anderen großen Gralsdichter betrachtet: Chretien de Troyes.
In seiner Trilogie entwirft Eschenbach ein Gesellschaftsbild, das zunächst historisch erscheint, aus dem der heutige Leser jedoch erkenntnistheoretische Wege ableiten kann.. Erkenntnistheoretisch deshalb, weil die Wege, die von den Helden zu bewältigen sind, einmal auf Erkenntnis und zum anderen auf die unterhaltsame Belehrung* der Leser -bzw. Zuhörerschaft zielen. Die auf Gralswegen dahineilenden Helden prägt Religiosität als treibende Kraft im Sinne einer individuellen Gotteserfahrung, die außerhalb der institutionalisierten Kirche geschieht.
Immer wieder ist nach den historischen Hintergründen des „Parzival“ gefragt und gesucht worden. Einige Forscher gehen heute soweit, in Eschenbach einen glaubwürdigen Chronisten zu sehen. Nun, bis zur Ausgrabung Trojas durch Heinrich Schliemann ist kaum ein Homer-Kenner auf die Idee gekommen war, aus dessen Epen Rückschlüsse auf reale historische Ereignissen zu ziehen. Schliemann war wohl der erste Forscher, der einen Dichter beim Wort nahm und dafür prompt mit der Bestätigung seiner Theorie belohnt wurde. Heute gilt er als Mutmacher für Forscher, die von der Glaubwürdigkeit literarischen Überlieferungen ausgehen.
Unsere Forschung ist künstlerischer Natur, die Identität zwischen einem legendären und einem geographisch tatsächlich nachzuweisenden Ort ist für uns zweitrangig.
Dennoch beziehen sich einige der Arbeiten direkt oder indirekt auf solche legendären Orte.
Da ist zum Beispiel das Bild „Die Schlacht von Alyscamps“, die in Eschenbachs Epos „Willehalm“ eine zentrale Rolle spielt. Willehalm war im 9. Jh. ein Fürst in Orange, der die Grenze des Königreichs gegen die Araber verteidigte und dabei vom „König Loys“ schmählich im Stich gelassen wurde. Diese Schmach war später der Grund, weshalb jeder Hinweis auf diese Schlacht zwischen Christen und Arabern aus den Chroniken gelöscht wurde. Offiziell hat diese Schlacht nie stattgefunden, Eschenbach beschreibt sie jedoch wie ein Kriegsberichterstatter, der dabei war, als auf den Alyscamps von Arles die Entscheidung fiel.
Oder das Bild „Wache vor Lît marveile“: es bezieht sich auf das gleichnamige Zauberbett im „Parzival“, das mit Gâwân hin und her rast und mit ihm macht, was es will. Das Bett ist ein Symbol für die unbewußten Triebe, die der Mensch überwinden und beherrschen muß.
Dieses Bild entstand in einem Schloß in Wales, für das der Name „Clinschors Zauberschloß“ durchaus angemessen gewesen wäre .
Für uns sind die Orte der Gralsepen Suchpunkte, die poetische Energie freisetzen. Wichtiger als die Orte sind uns die Menschen, die uns während der „Suche“ begegnen: sie sind das eigentliche Ziel, sie sind die lebendiger Träger der europäischen Wurzeln.
Der Blick in die Zukunft ist ohne Rück-Sichtnahme schwer zu gewinnen. Eschenbach dürfte das erfahren haben, denn auch er hat zurückgeschaut und eine komplexe Antwort hinterlassen, formuliert aus der Perspektive seiner Gegenwart. Die Ereignisse, die er schildert, handeln vor seiner Zeit, aber er beschreibt im Rückgriff sehr genau die Gegenwart, in der er an der Wende vom 11. Zum 12. Jh. lebte.
In Eschenbachs Werk wird zwar nicht die Frage gestellt, wie es mit Europa weitergeht, aber seine Epen implizieren eine andere Frage, die fundamental und gerade in Zeiten des Umbruchs bezeichnend ist: die Frage nach den Werten, nach dem Sinn, nach dem Erstrebenswerten. Auch dafür steht der Gral.
Eschenbachs Werk behandelt im Grunde die individuelle Verantwortung bis hin zum christlichen Motiv der Aufopferung, das Scheitern an individuellen Glücksansprüchen erscheint bei ihm als Vorbedingung für den Dienst an der Gemeinschaft.
Die Moderne, sagt man, beginnt mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahre 1492. Mittlerweile weiß man, daß Kolumbus keineswegs der erste Europäer war, der über den Atlantik segelte, das vermochten bereits die Wikinger einige Hundert Jahre vorher. Wo beginnt also Europa? Vor der Sphinx von Theben? Mit Abrahams Auszug aus Ur? Auf dem Athener Pnyx? Auf den sieben Hügeln Roms? Mit dem Stein der Könige und dem keltischen Mythos vom wüsten Land? Mit der Gründung von Städten und Klöstern durch iro-schottische Mönche in Mitteleuropa? Mit dem Kreuzzug gegen die Katharer?
Europa beginnt im Anderswo, in der Autre Monde, dem Ort des Wandels und des Übergangs. Die Autre Monde ist Ziel und Weg zugleich.
Autre Monde ist keine Übersetzung aus dem Deutschen, sondern ein fester literarischer Begriff, mit dem ein bestimmtes Element aus den keltischen Überlieferungen gemeint ist, nämlich die Suche nach dem Anderswo, nach einem Ort der Wandlung, manchmal auch nach dem Paradies, wie in der Geschichte des St. Brendan.
Aufbruch, Wagnis und Suche sind eng mit dem Begriff der Autre Monde verbunden, haben aber auch gleichzeitig einen ausgeprägten Bezug zum Themenkreis der Gralslegenden.
Dies ist, kurz gesagt, der Hintergrund, aus dem heraus die Resultate der Arbeit am Projekt „Wurzeln Europas/Der Gral“ entstehen.
In den nun folgenden Bildbeschreibungen wird der Versuch unternommen, diesen Hintergrund auszuleuchten und Zusammenhängen nachzuspüren, die tiefer hineinführen in die poetische Dimension der Bilder.
* “Der ‘Parzival’ muß eine literarische Sensation gewesen sein“. Im 13. Jh. ist keine andere Dichtung so oft zitiert und so häufig kopiert worden.“ „Wir besitzen über 80 Handschriften und Fragmente... (zum Vergleich: vom ‘Nibelungenlied’ sind 35 Handschriften und Fragmente bekannt...)“ Joachim Bumke, „Wolfram von Eschenbach“, Sammlung Metzler 1991, S. 170/17
Europa

Ein verwirrendes Gemisch nicht gleich identifizierbarer Teile und Teilchen füllt den Bildraum.Man erkennt Europafähnchen, Sterne, glitzernde Kristalle und eine Frau, die aus der Bildmitte am Betrachter vorbeizuschauen scheint. Wo befindet sich das, was man hier sieht, fragt man sich unwillkürlich. Die Frage bleibt offen wie in anderen Fällen, in denen die Fotografin den tatsächlichen Ort der Aufnahme nicht mitteilt, weil eine solche Mitteilung den inhaltlichen Impuls verwischen könnte und eine Lokalisierung thematisch nicht in jedem Fall wichtig ist. Die Fotografin arbeitet jedoch stets in Räumen, die sie findet, und so phantastisch manche Räume in ihrer Bildwelt auch anmuten, haben sie doch immer eine reale Entsprechung und wurden nicht extra für eine Aufnahme hergerichtet.
Das Bild hat den Titel Europa und entstand im Februar 1993. Für eine Ausstellung in der Leipziger Kulturfabrik Werk II (Mai-Juli ‘93) wurde dieses Bild im Format 75 x 100 auf Leinwand vergrößert und, aufgezogen auf Keilrahmen und in einer Plastik aus Stahl (176 x 124) gerahmt.
Edith Tar fertigte die Rahmen in einer Schlosserei und hat mit einem Plasmabrenner ein Zitat aus einem meiner Gedichten in den Stahl gebrannt. Der Text zu diesem Bild lautet:
„Die Sterne Europas kreisen um das schwarze Loch der Warenhäuser“.
Im Zyklus der Bilder, die zum Projekt „Wurzel Europas/Der Gral“ entstanden sind, hat dieses Bild einen besonderen Stellenwert, da Edith Tar mit diesem Bild einen Grundriß liefert, auf dem ihre künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema aufbaut. Charakteristisch für diesen Grundriß ist einmal die Hinwendung zum einzelnen Menschen, repräsentiert durch das jeweilige Modell, dem sie zumeist eine zentrale und bildtragende Funktion zumißt, zum anderen das Hineingestelltsein des einzelnen Menschen in ein über seine Gegenwärtigkeit hinausweisendes Beziehungsgefüge. Ein weitere Eigenheit besteht im rein sinnlichen Genuß, den das Bild bringt: die Lust an Farben und Formen ist ausgeprägt, manchmal von fast kindlicher Vitalität, so daß selbst komplizierte Bildchiffren mit hintergründigen Gedanken-führungen nie schwer und dumpf erscheinen.
Im Bild Europa ist das ungebrochen zu spüren, der Betrachter kann sich anstecken lassen vom naiv-faszinierten Staunen angesichts der vielen glitzernden Dinge und dem flimmerndem Gold.
Wohl kaum ein politischer Begriff der Gegenwart leidet so unter Abgegriffenheit wie das Wort Europa. Dennoch ist das Wort nicht zur Worthülse verkommen und taugt nach wie vor als Schlüsselwort für eine Umbruchsituation, die seit 1989 akut geworden ist.
Worauf bezieht sich der Bildtitel? Auf die Europafähnchen? Auf die Sterne? Auf den schwer zu bestimmenden Raum? Die Antwort liegt in einem komplexen Wechselspiel der einzelnen Kompositionselemente, weshalb es ratsam ist, zunächst die Gesamtwirkung des Bildes in Augenschein zu nehmen.
Nehmen wir einmal an, Europa würde durch die Frau im Zentrum des Bildes repräsentiert.
Eine hohe Stirn, das lange Haar zurückgekämmt, den Blick fest auf einen Punkt gerichtet, beinah so, als würden die Augen geblendet. Ihr Kopf erscheint verschmolzen mit dem goldenen Flimmer, der ihn umgibt, aber das dem Betrachter zugewandte Gesicht hebt die Person deutlich ab vom verklärenden Schein. Schaut man genauer hin, erkennt man auf der Stirn der Frau Sterne und über ihrem Kopf eine Art Krone.
Die Körperhaltung steht im Gegensatz zum gespannten, fast forschenden Gesichtsausdruck und erinnert an die Momentaufnahme einer Tanzenden. Denkt man sich diese Person aus der Mitte des Bildes weg, erkennt man ihre Bedeutung: ohne sie hätte das Bild keine Membran, d.h. es gäbe keinen Hinweis auf einen strukturellen Zusammenhang, abgesehen von der aus dem linken unteren Bildrand ins Bild ragenden Modepuppe, die in der über den Kopf erhobenen Hand ein Europafähnchen hält.
Die Modepuppe bringt stilistisch die „goldenen Zwanziger“ ins Bild und ist deutlicher wahrnehmbar als die Frau im Zentrum. Mit dieser Puppe drängen sich Anspielungen auf, die dem Bild einen virtuellen Fond verleihen, denn die zwanziger Jahre waren in kultureller und künstlerischer Hinsicht eine innovative Phase, die ohne die gesellschaftliche Katastrophe des 1. Weltkrieges nicht denkbar ist. Zugleich war es die Phase, in der die kommunistische Utopie in eine dem machtpolitischen Kalkül folgende Ideologie kippte und der Faschismus Tritt faßte.
Neben diesem zeitgeschichtlichen Aspekt impliziert die Puppe aber auch einen ironischen, der auf die Frage hinausläuft, ob man Europa besser mit dieser Puppe als mit jener lebendigen Frau assoziieren sollte: immerhin ist es die Puppe, die das Europafähnchen hochhält.
Für welche Deutung der Betrachter sich auch entscheidet, die Frau in der Bildmitte und die Puppe links außen bilden ein Gegensatzpaar, das dem eigentlich unbestimmbaren Raum seine Bestimmung gibt.
Es ist übrigens ein Raum, der durch die Komposition der Farben einsichtig wird, denn über der Frau in der Mitte schwingen goldfarbene Linien nach links oben und rechts oben weg, so daß der Eindruck eines beiseite gezogenen Vorhangs entsteht, der durch den dunklen oberen Bildteil fortgeführt wird und insgesamt an ein Zirkuszelt erinnert.
Ein Zirkuszelt, dessen unsichtbare Kuppel voller Sterne hängt, die keinen Zweifel daran lassen, daß sie künstliche Leuchtkörper in einem künstlichen Himmel sind, aus dem rechts oben ein barockes Engelgesicht aufscheint. Das Gesicht des Engels in seiner barocken Zufriedenheit, die erstarrte Selbstverliebtheit der Puppe und die beobachtende Erwartungshaltung der Frau in der Bildmitte formulieren einen Zeitgeist, der in sich selbst zurückgezogen erscheint: etwas dringt von Außen ein, hebt den Vorhang, kommt näher - aber in die Szenerie selbst ist diese verändernde Kraft noch nicht vorgedrungen.
Zirkuszeltähnlicher Bildaufbau, Puppe und Interieur sind insgesamt Attribute der Schaustellerei, eines fahrendes Gewerbes also, dessen Sinn im Kontext zum Bildtitel eine zweischneidige Interpretation erlaubt: entweder handelt es sich um eine Show, die auf Trick aufbaut und mit der Illusion der Zuschauer spielt, dann reduzierte sich Europa auf die bloße Unterhaltung, oder es wird genau dieser Aspekt ihres Wesens in Frage gestellt, dann ergibt sich eine Art Ent-Larvung, d.h. aus der Puppe schlüpft ein lebendiges Wesen, das in einem empfindlichen Stadium der Wandlung Schutz braucht.
Europa war eine Prinzessin aus Phönizien, die von Zeus in Stiergestalt entführt wurde.
Es war diese Entführte, die unserem Kontinent den Namen gab. Aber noch etwas zu den Sternen, die im Bild „Europa“ funkeln.
Die antiken Griechen haben den zu ihrer Zeit und aus ihrer Perspektive von Süd nach Nord zielenden Kulturimpuls in das nicht abzutragende Kleid des Mythos gehüllt. Ihnen verdanken wir auch die Namengebungen der Lichtfiguren am Nachthimmel. Schaut man sich die Namen der Sternbilder an, so sind sie in ihrem Kern eng verbunden mit den Götterwelt der Griechen.
Da Sterne natürlicherweise in der Nacht die einzige Orientierungsmöglichkeit bieten, ergibt sich hier ein weiterer metaphorischer Aspekt, der die Frage nach der Richtung erlaubt, in die Europa gehen wird.
12 Sterne sind es, die in der Europafahne auf blauen Grund einen Kreis bilden: es liegt nahe,die Zwölfheit auf die 12 Tierkreiszeichen, und damit irdisches Geschehen auf kosmisches Raum-Zeit-Gefüge zu beziehen.
Vor diesen Überlegungen erscheint die Frau in der Bildmitte als Trägerin eines Vorgangs,von dem sie ahnt, daß ihr keine andere Wahl bleibt, als ihn anzunehmen. So wie die phönizische Prinzessin den Göttervater Zeus annehmen mußte, wohl wissend, daß ihre Kinder das Labyrinth erbauen und in seiner Mitte den Menschenopfer fordernden Minothauros einsperren werden.
Europa ist ein Rätselbild, das andere Deutungen zuläßt als die hier vorgeführte. Man muß nicht die griechische Mythologie bemühen, um Zugang zu diesem Bild zu finden, das eine Europa vorführt, die ihren Sinn finden muß, der gewiß nicht in diesem (Vorstellungs-) Raum liegt, so funkelnd, geschmeidig und phantastisch dieser auch sein mag.
11.8.97
Ende des Kalten Krieges
 Das Bild entstand am 17. April 1993 in Charlottenhof bei Görlitz, wo konventionelle Militärtechnik laut den Wiener Abrüstungsverträgen verschrottet wird. Edith Tar war dorthin gefahren, um von der Metall Rohstoff Thüringen GmbH zwei Kanonenrohre zu kaufen, die sie für ihre Skulptur „Muschelaltar“ brauchte.
Das Bild entstand am 17. April 1993 in Charlottenhof bei Görlitz, wo konventionelle Militärtechnik laut den Wiener Abrüstungsverträgen verschrottet wird. Edith Tar war dorthin gefahren, um von der Metall Rohstoff Thüringen GmbH zwei Kanonenrohre zu kaufen, die sie für ihre Skulptur „Muschelaltar“ brauchte.
Das Bild zeigt das Innere einer Halle aus Wellblech, in der Panzer vom sowjetischen Typ T 55 stehen.
Vier Kanonenrohre ragen von rechts unten nach links oben, wobei die letzten beiden Rohre in ihrer Verbindung mit dem Turm der in Reihe stehenden Panzer zu erkennen sind. In der Dachkonstruktion sieht man Neonröhren, die als weiße Balken die rhythmische Ordnung der Panzerrohre fortsetzen.
Den aufgereihten Panzern gegenüber befindet sich ein Arsenal von Metallteilen, die nicht zuordenbar sind.
Die Bildmitte füllt der Oberkörper eines jungen Mannes, der unter einer geöffneten Wetterjacke einen Rollkragenpullover trägt und den Kopf gesenkt hält. Ob er durch seine Brille zu Boden schaut oder die Augen geschlossen hält, ist nicht ganz klar. Der entspannte Gesichtsausdruck erinnert an einen Schlafenden und steht im Widerspruch zur gebeugten Körperhaltung, die auf Nachdenklichkeit, nicht aber auf eine zu tragende Last schließen läßt. Betrachtet er den Boden, auf dem er steht? Ist sein innerer Blick auf seinen geistigen Lebensgrund gerichtet? Der junge Mann wirkt wie eingeblendet in den Hangar, fast wie eine Erscheinung, und auf bestimmte Weise abwesend oder nicht involviert.
Der "Kalte Krieg" ist ein Begriff für den Kampf zwischen den Ländern des WARSCHAUER PAKTES und der NATO. Dieser Kampf schloß stets die Latenz des wirklichen Krieges ein, zu dem es unter anderem deshalb nicht kam, weil die Mehrzahl der Menschen sich nicht mit der herrschenden Macht identifizieren konnten. Ausdruck dieser Nichtidentifikation war das, was ich als Abwesenheit bezeichne; persönliche Einmischung in das politische Tagesgeschäft war in der DDR gefährlich und wenig erfolgversprechend, also ließen es viele sein...
Der Historiker Alexander Demandt schreibt in einem Aufsatz über das „Ende der Weltreiche“: „Die Denkverbote der marxistischen Zensur und der verlauste Filz der Nomenklatura, die schikanösen Freiheitsbeschränkungen und die hoffnungslose wirtschaftliche Rückständigkeit gegenüber dem Westen brachten das System um seine Glaubwürdigkeit. Die Dissidenten mehrten sich, Intellektuelle und Nationalisten sagten sich vom Kommunismus der alten Männer los und liquidierten von innen heraus das letzte Kolonialreich, dessen martialische Fassade alle Welt über seine Strukturschwäche zu täuschen vermocht hatte. Daß dies im wesentlichen unblutig gelang, ist der größte Triumph, den der Gedanke der Freiheit in seiner Geschichte bisher erlebt hat.“
Der Gedanke der Freiheit muß von Menschen gedacht und ausgehalten werden. Um diesen Gedanken in sich auszuformen, muß der Einzelne bei sich selbst einkehren und den Boden prüfen, auf dem er physisch und geistig steht. Die Kanonenrohre sind Ausdruck einer bestimmten Art der Konfliktaustragung. Träger jeglicher Konflikte ist aber der Mensch, und er bestimmt die Wahl der Waffen.
Leipzig, 8.9.97
Alexander Demandt: Das Ende der Weltreiche, Verlag C.H. Beck München 1997 S. 219
Bethlehem
Der Besuch Bethlehems war die letzte Station auf unserer Reise durch Israel im Februar und März 1996. Der Aufenthalt war von mehreren Schockwellen durchdrungen, ausgelöst durch die Selbstmordattentate der Hamas in Jerusalem und Tel Aviv. Bethlehem liegt von Jerusalem nur 20 km entfernt, mit dem Taxi braucht man keine halbe Stunde, die Kontrolle am Checkpoint zur Westbank eingeschlossen.
Zur Eröffnung einer Ausstellung im Lichthof der Alten Nikolaischule in Leipzig, wo im Mai ‘96 eine erste Auswahl der Israel-Fotos gezeigt wurde, sprach Joshua Modlinger, ein 1915 in Lemberg (Lwow) geborener Jude, den wir in Jerusalem kennenlernten. Er sagte: „Ich habe Hunderte Bilder der Geburtskirche in Bethlehem gesehen, aber kein einziges brachte das zum Ausdruck, was ich in dem Bild gesehen habe, das Edith von diesem Ort gemacht hat... Ich habe in diesem Bild ihr eigenes Leuchten gesehen, das eins geworden ist mit dem Leuchten der Sonnenstrahlen, die in die Kirche eindringen, so als hätte sie den Christus gesehen.“
Diese Aussage trifft den emotionalen Kern, aus dem heraus das Bild entstanden ist. Das Bild ist von einer hohen Schlichtheit getragen, es vibriert von einer Zwiesprache mit dem Licht.

Der Ort Bethlehem ist für Juden und Christen gleichermaßen von Bedeutung.
Hier starb Rahel, die Frau Jakobs, bei der Geburt ihres Sohnes Benjamin. Hier begegnete die Ährensammlerin Ruth ihrem späteren Gemahl Boas, und beide wurden die Stammeltern des Hauses David, aus dessen Geschlecht Jesus hervorging.
Jesus Christus wird mit dem Licht gleichgesetzt, und das Licht ist es, was in diesem Bild die Spannung erzeugt, die gleichwohl einhergeht mit einer fast unerträglichen Ruhe und Ausgeglichenheit.
Der Raum der Geburtskirche zeigt links und rechts eine Reihe von je sieben Säulen, von denen der Betrachter nicht weiß, was sie tragen. Da das Licht durch seitlich gelegene Fenster einfällt, die als solche nicht wahrnehmbar sind, wird der Kontrast zum lastenden Dunkel im oberen Bildteil besonders augenfällig. In der perspektivischen Verjüngung des Säulenganges wird der Blick des Betrachters ins Zentrum des Bildes geführt, das aus einer einfachen, schmucklosen und vielleicht gerade deshalb faszinierenden Wand besteht.
Die Wand erscheint als Schlußstein, ein Dahinter scheint schwer vorstellbar. Das Dunkel lastet auf diesem Ende des Säulenganges und läßt dem Auge keine andere Wahl, als zum Bildeingang zurückzukehren.
Hier angekommen, beginnt der Gang aufs Neue, der Blick wird wieder ins Innere gezogen, nimmt nun vielleicht die ins Abstrakte wegflatternden Goldpunkte wahr, die oben zwischen den Säulen glimmen (es sind Weihrauchgefäße), und prallt erneut auf die Wand, auf den Schlußstein.
Für einen in Europa aufgewachsenen Christen kann dieser Kirchenraum durchaus eine ungeheuerliche Wirkung haben, denn er ist leer, es gibt ihn ihm keinen Schmuck, keine Bilder. Die Leere des Raumes erinnert daran, daß auch das innerste Heiligtum jenes Tempels leer war, der nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil anstelle des zerstörten Salomonischen Tempels errichtet worden war, in welchem bis zur Belagerung der Stadt durch Nebukadnezar die Bundeslade stand.
Wer die Kirche als Besucher betritt, wird sie kaum so leer sehen wie auf diesem Bild, denn normalerweise ist die Kirche stark frequentiert von Pilgern und Touristen, aber auch von arabischen Christen. Die Abwesenheit von Personen in diesem Bild mag verschiedene Deutungen erlauben, für mich ist es ein unaufdringlicher Hinweis auf eine zentrale christliche Lehre: die Überwindung der Subjektivität. Gleichzeitig erkenne ich darin eine Allegorie auf das Verlassen subjektiver Vorstellungen, denn der leere Raum repräsentiert in seiner Verlassenheit eben jenen Zustand, der für überwundene Vorstellungen charakteristisch ist: in Wirklichkeit ist jeder All-Ein.
Die Kirche wurde 325 unter Konstantin den Großen über einem Adonistempel errichtet, den wiederum Hadrian 135 über der Grotte bauen ließ, in der Jesus geboren wurde. 529 zerstört, wurde sie wenig später unter Justinian nach dem alten Schema wieder hergestellt.
614 eroberten Perser das Land und verschonten die christliche Kirche, weil sie an der Kleidung der Figuren-gruppe, die über dem Türsturz eingemeißelt war, Landsleute erkannten. Die Figurengruppe zeigte die Hl. Drei Könige, die aus Persien nach Bethlehem gekommen waren, um dem „König der Welt“ zu huldigen.
Im 13 Jh. wurde der Eingang verkleinert, um zu verhindern, daß Mamelucken hoch zu Roß in das Heiligtum einreiten. Seitdem hat der Eingang eine Höhe von 1.20 m und erinnert dadurch auf merkwürdige Art an den Eingang in irgendeine Gesteinshöhle.
Unter der Kirche befinden sich die Höhlen von Bethlehem, und in einer von diesen Höhlen, die den Hirten der Gegend als Ställe für Ziegen und Schafe dienten, richtete sich 386 Hieronymus häuslich ein, um die Heilige Schrift ins Lateinische zu übersetzen (die Vulgata). Einige dieser Höhlen sind voll von religiösen Gegen-ständen, Bildern und Reliquien. Hierhin trifft kein Lichtstrahl, und wer dort, aus dem Licht der Kirche hinab kommend, länger verweilt, kann die Magie chthonischer Kräfte empfinden. Die Kirche selbst erschien mir wie ein jüdisches Tauchbad, gefüllt mit Licht.
Das äußere Erscheinungsbild des Baus läßt eine solche Erfahrung nicht erwarten. Händler bieten Souvenirs feil, Taxifahrer warten auf die Rückkehr ihrer Fahrgäste. Schräg gegenüber der Kirche, linker Hand des Markt-platzes, ist der Sitz einer palästinensischen Selbstverwaltungsbehörde. Auf dem Platz stehen Polizeimotoräder der Marke MZ aufgereiht hinter einer Absperrung, weiter oben beginnt der Markt.
Aus religiöser Sicht vollzieht sich alles Weltgeschehen im Kontext der Heilserwartung. Im Bethlehem -Bild wird das Geschehen der Welt an das Auge des Betrachters verwiesen,der zwischen Licht und Schlußstein auch die letzte Eitelkeit überwinden darf: die Suche nach einer endgültigen Antwort auf die Frage nach dem Sinn.
Das Licht der Sonne ist konstant, es erleuchtet einmal die Nord- einmal die Südhälfte der Erde. Talmudisten und Chassidim erheben sich deshalb um Mitternacht zum Gebet, weil der Mensch das einzige Bindeglied
zwischen Licht und Finsternis ist; die Wachheit des Menschen erscheint als einzige Chance für die Kontinuität der Schöpfung, deren wesentliche Form das Licht selbst ist. Das Licht nimmt die Erscheinungen der materiellen Welt auf sich: es ist Träger der Verheißung und Medium der Sinnsuche - diese Assoziation drängte sich zumindest mir bei der Betrachtung des Bildes Bethlehem auf.
8.8.97
Die Tage des Skorpion
Ein Landschaftsbild herbstlicher Melancholie, monochrom verschleiert vom Regen, entstanden an einem Novembertag 1998 in der Muldenlandschaft bei Grimma.
Eine leere Straße, die nach links aus dem Bild führt, beidseitig gesäumt von Bäumen. Ein roter, zerfasernder Fleck im rechts vorn stehenden Baum verleiht der gedämpften Stimmung etwas nervös Vibrierendes, läßt sich aber nicht genau einordnen: unwahrscheinlich, daß da etwas brennt. Was ist es dann? Die Antworten bleiben Spekulation und verschwimmen wie der Regen im Bild.
Neben den starken graphischen Aspekten reizt mich an diesem Bild vor allem die unsichtbare Spiralbe-wegung, die zwischen Himmel und Erde verläuft. Dieser eigentlich nicht sichtbare Aspekt, der sich für mich aus dem Bild ergibt, hat mich dazu veranlaßt, in „Die Tage des Skorpion“ eine Metapher für den Weg nach Haus zu sehen.
Warum? Die Straße läuft nach links abbiegend aus dem Bild, während der Himmel in perspektivischer Umkehrung aus der selben Richtung zu in den Bildgrund eindringt und ihn beinah überschwemmt mit einem diffusen Lichtgrau.
Die Suggestion des Graphischen basiert auf einer Hell-Dunkel-Komposition, in der ich eine Übersetzung der Dualität zwischen Bleiben und Fortgehen in eine atmosphärisch dichte Zeichnung sehe. Beeindruckend an diesem Bild ist, wie welchem Höchstmaß an objektiver Wahrnehmung der Zustand einer Orientierungslosigkeit wiedergegeben wird.
Die Tatsache, daß dieser Zustand ganz einfach nur witterungsbedingt ist, steigert die Wirkung des Bildes in etwas düster zauberhaftes, dessen Unwirklichkeit um so eindringlicher empfunden werden kann, als es so offenkundig eine nachvollziehbare Situation vertrauter Wirklichkeit beschreibt.
Den Weg nach Haus geht oder fährt man täglich, daran ist nichts besonderes.
Aber es kann geschehen, daß in die routinierten Handlungsabläufe etwas einbricht, das zum Anhalten zwingt - und wer in diesem Moment innehalten kann, erfährt plötzlich etwas über die Zerbrechlichkeit der Bezüge, in denen wir so selbstverständlich leben.
Die dunklen Figuren der Bäume assoziieren Bedrohliches, denn ihre Klarheit inmitten der verschwimmenden
Landschaft bietet eine Orientierung, deren Sprache und Intention so anziehend wie unverständlich ist.
Der Weg nach Hause scheint plötzlich gefährlich. Möglicherweise handelt es sich sogar um einen Irrweg?
Irrwege geht, wer fehlt. Abwesenheit und Fehlen ist der Stoff, aus dem das Bild gemacht wurde.
Und wo jemand fehlt, da begegnet er über kurz oder lang Gespenstern als den Emanationen seiner Abwesenheit. In diesem Zustand sieht man sich aus allen Verbindlichkeiten entlassen.
Damit bietet sich die Möglichkeit einer Neuorientierung, einer inneren Korrektur.
Die Vibration in diesem Bild gleicht jener mit unendlichen Möglichkeiten aufgeladenen Membran zwischen Licht und Schatten, die in solchen Momenten physisch erfahrbar wird.
Die Symptome reichen von einfacher Gänsehaut über erhöhte Sensibilität bis zu dem positiven Schock, der sich manchmal mit der blitzartigen Erkenntnis verbindet, daß man alles im Leben ändern kann.
Das kann Angst auslösen, die phantastischen Wesen im Geäst der Bäume signalisieren es
eindringlich. Diese nicht genau erkennbaren Wegelagerer, Emanationen der Abwesenheit, verhindern ein Vorwärts, sind aber gleichzeitig auch Prüfstellen für das Maß an Mut, das man für ein Weitergehen aufbringen muß.
In der christlichen Terminologie wird die Verfehlung mit Sünde gleichgesetzt. Beide Worte bezeichnen im Wortsinn ein Fehlen, das sich in jede Suche einschreibt, und den Weg nach Haus zu einem Weg in das Ungewisse macht. Und es ist das Ungewisse, an dem wir die Gewißheit messen.
Kaditzsch, 10.11.98 / Leipzig,15.9.99
Garten Gethsemane

Das Bild entstand 1996 im Garten Gethsemane in Jerusalem. Es zeigt den Stamm eines sehr alten Olivenbaumes, links daneben steht am Boden eine blecherne Gießkanne. Ein stilles Bild, das bei näherer Betrachtung aufwühlen kann, denn was erzählt uns die Fotografin da, die absichtsvoll einen Bildausschnitt gewählt hat, den ein vorübergehender Tourist sicher nicht in den Fokus genommen hätte?
Hier symbolisiert der Olivenbaum als Kulturpflanze die Mitte einer menschlichen Gemeinschaft, wie wir sie schon in antiken Gemeinwesen wie Athen vorfinden: Athena bringt den freien Bürgern der Stadt einen Olivenzweig, er ist das heilige Zeichen eines Bundes. Das gleiche Zeichen eines Bundes zwischen Menschen und Gott findet sich in der biblischen Geschichte von der Sintflut, da bringt eine Taube den Olivenzweig an Bord der Geretteten.
Die Gießkanne bezeichnet die Verantwortung des Menschen für die Kulturpflanze, die hier zum eigentlichen Kern der menschlichen Gemeinschaft wird, um die sich soziale, kulturelle und religiöse Verbindlichkeiten aufbauen und strukturieren. Der Mensch muß den Baum seiner Kultur hegen und pflegen, durch Perioden der Trockenheit bringen, vor Schädlingen schützen usw. Und es waren von jeher die Bäume, die den Menschen vorgelebt haben, wie man dem Himmel, der gedachten Wohnstatt Gottes, entgegen wächst.
Durchmesse ich diesen Gedankenraum in Betrachtung des Bildes, kehrt mein Blick unweigerlich zurück zur Gießkanne, die auf der Erde steht, und zum Baum, der in der Erde wurzelt. Den Himmel kann ich im Bild selbst nicht sehen, aber es scheint, als atme das Bild die Weite des Himmels.
Das Bild verknüpft auf schlichte Weise philosophische und religiöse Punkte, die unsere Gesellschaft zentrieren: das verantwortliche, der Gemeinschaft verpflichtete Handeln einerseits, basierend auf einem veränderlichen, aber doch seinsphilosophisch begründetes Regelwerk. Andererseits geht es um den Kern christlicher Botschaft, zu der das Geschehen im Garten Gethsemane – von der Tat des Judas und allem, was bis zur Auferstehung folgt - notwendig dazugehört.
Zudem ist auch der Garten Grundidee einer kulturellen Einhegung der Wildnis, also eine Anspielung auf den Garten Eden und somit auf die Wiederkehr in das Reich Gottes, zu dem uns Jesus Christus das Tor geöffnet hat. Manchmal genügt eine Gießkanne, um zu begreifen, wie wir in unseren Taten dem Himmel entgegen wachsen.
aufgezeichnet nach Gespräch mit Edith Tar am 14.11.2015, 11 Uhr
Orakel von Delphi

„...alles Wissen scheidet sich
an der Quelle in Macht & Gesang.“
Das Bild entstand im November ‘94 an der kastalischen Quelle von Delphi in Griechenland. Es zeigt eine Frau vor einer Felswand, an deren Fuß sich die antike Brunnenstube befindet. Man erkennt in der Felswand Einlassungen für Balken, die einmal das Dach der Brunnenstube getragen haben, sowie eine größere Höhlung mit einem Säulenfragment.
Die Erscheinung der Frau wirkt zeitlos, sie ist in lange Kleider gehüllt, ihr Haar verborgen von einem Tuch. Offensichtlich handelt es sich um eine junge Frau, aber ihre Schönheit ist auf seltsame Art unberührt von Eros, ohne dessen Zauber jene Liebesenergie nicht fließen kann, die Leben erst in Gang setzt.
Das Weibliche erscheint hier herausgehoben aus dem Zyklus des Gebärens und Bewahrens von Leben und wird somit über seine natürliche Bestimmung gestellt. Die Körpermitte der Frau ist regelrecht ausgeblendet, immateriell. Das heißt: dort, wo sie das neue Leben tragen könnte, wird sie durchscheinend und eins mit einer zweiten, etwas kleineren Nische in der Felswand.
Das Einssein der leeren Felsenhöhle und der leeren Bauchhöhle empfand ich während der Betrachtung des Bildes als gespenstisch - bis mir der Gedanke kam, daß die Frau soeben aus dem Fels herausgetreten sein könnte ins Leben. Warum?
Der Stein und das Wasser stehen in diesem Bild in einer unsichtbaren Wechselwirkung, deren eigentlicher Ausdruck die Frau ist. Und die Frau, die hier steht, ist die Pythia.
Die Pythia ist die Brücke zwischen dem Reich der Götter und dem unwiederbringlichen Fluß des Lebens. Ihr Spruch konnte dem Lebensfluß eine völlig neue Richtung geben, einige wichtige Daten der antiken Geschichte stehen in engem Zusammenhang mit ihrem Ratschluß.* Die Pythia fungierte im Tempel des delphischen Apollon als Jungfrau, die das Orakel sprach. Und bevor sich ein Pilger ihr ratsuchend näherte, unterzog er sich einer rituellen Reinigung in der kastalischen Quelle, die das ursprünglich der Erdmutter Gäa geweihte, weitaus ältere Heiligtum von Delphi war.
Heute liegt der zentrale Zugang zum Tempelbezirk vor dem asphaltierten Parkplatz. Als wir Ende Oktober dort waren, fanden nur wenige Touristen den Weg in die bewaldete Schlucht.
Während die Fotografin mit ihrem Modell an der Kastalischen Quelle arbeitete, bin ich in die sich hinter dem antiken Lustrationsort öffnende Schlucht gestiegen. Dorthin dringen die dumpfen Bässe der vorbeifahrenden Lkws nicht mehr, die Felsbrocken türmen sich, unter den Füßen brechen trockene Äste. Die Schlucht verjüngt sich und endet nach etwa 100 m vor einer steil aufragenden Felswand. Eine Weile habe ich vor dieser Wand gestanden und den Kopf gereckt, um den blauen Himmel zu sehen. Das Blau schien mir in dem Moment unerreichbar und kostbar zugleich. Ich stand im einstigen Heiligtum der Erdgöttin Gaia war, und die Schlucht erschien mir als tiefer, steinerner Schoß, an dessen Grund die Quelle entspringt. Als ich mich umwandte und zurückging, wurde die Schlucht zu einem sich öffnenden Weg, zu einer Geburt, und ich kam mir vor, als krieche ich unter einem riesigen, umgekippten Dreifuß hervor, zurück in die Welt der Eintrittskarten.
Die Pythia saß auf einem Dreifuß über einer Erdspalte. Man nimmt an, daß aus dieser Erdspalte Dämpfe aufstiegen, die sie in Trance versetzten. Indem der Atem aus dem Erdinnern eins wurde mit ihrem Atem, verlor sie ihre subjektive Wahrnehmung und war in der Lage, den Willen der Götter zu verkünden.
Bevor die Pythia zu einem in der antiken Welt berühmten Medium wurde, herrschte an ihrer Stelle der Drachen Python: er war ein Sohn der Erdmutter Gaia und bewachte ihr Heiligtum. Als Apollon ihn tötete, muß ihm die Tragweite seiner Handlung klar gewesen sein, denn nach diesem Mord diente dann Gott Apollon sieben Jahre lang einem sterblichen König, um diese Tat zu sühnen. Die Tragweite des Vorgangs wird deutlich, wenn man bedenkt, daß hierdurch Apollon zum Gott der Entsühnung wurde, d.h. vor seiner Tat konnte eine Blutschuld nur durch Blut entsühnt werden. Der delphische Apollon steht damit auch für einen zivilisatorischen Impuls, der die Rechtsauffassung radikal veränderte.
Basis dieser Reform ist die Übernahme des Gaia-Heiligtums durch den Gott Apollon.
Die Stimmkraft der Erdmutter (kastalische Quelle) ging über auf die Pythia, die damit zur Sprecherin Apollons wurde.
Die Übernahme des Heiligtums der Gaia durch Apollon datieren Archäologen in das 9. Jh. v.Chr., als Beweisführung gelten die im Heiligen Bezirk gefundenen weiblichen Idole.
Wann die weibliche Stimme zum ersten Mal die Wahrheit der Götter verkündete, liegt im Dunkel. Der Zeitpunkt ihres endgültigen Verstummens ist historisch gesichert: 392 n.Chr. verfügte Kaiser Theodosius I. die Schließung des Heiligtums.
Theodosius residierte übrigens in Konstantinopel, in einer Stadt also, die ohne das Orakel von Delphi nicht gegründet worden wäre: um 680 v.Chr. wies die Pythia Siedlern aus Megara den Weg zum Bosporus, und die gaben ihrer Kolonie den Namen Byzantion. Als hier Kaiser Konstantin im 3. Jahrhundert n.C. seine Hauptstadt gründete, wurde der Name einer kleinen hellenischen Kolonie zum Begriff für ein Reich, das mehr als 1000 Jahre bestand: Das byzantinische.
Für die Menschen der „Alten Welt“ war das Oben identisch mit dem Unten, und so war es selbstverständlich, mit den Strömen im Innern der Erde überall dort Kontakt zu suchen, wo die Erdkruste offen war: hier war die Stimme der Mutter Erde zu hören, die Stimme Gaias - und wer konnte diese Stimme besser verstehen als eine Frau, von der Natur dazu ausersehen, das Drama der Schöpfung am und im eigenen Leib zu erfahren.
Die Frau im Bild Orakel von Delphi hält einen Arm angewinkelt über ihren Bauch. Es ist eine Geste, die man von schwangeren Frauen kennt.
Die Pythia sprach ihr Orakel „aus dem Bauch“ und opferte damit ihre natürliche Bestimmung als Frau.
* zwei Beispiele:
547 v.Chr. sagte die Pythia König Kroisos voraus, er werde ein großes Reich zerstören, wenn er einen Fluß überschreite. Kroisos überschritt den Halys und wurde von den Persern vernichtend geschlagen. Das große Reich, das er zerstörte, war sein eigenes.
480 v.Chr. lautete das Orakel, Athen werde vor den Persern hinter einem hölzernen Schutzwall sicher sein. Themistokles baute eine Flotte auf, die sich in der Seeschlacht von Salamis als „hölzerner Schutzwall“ bestens bewährte, die Perser wurden geschlagen.
Leipzig, 3.9.97
Pythia/Delphi

Das Bild fokussiert die Pythia, wie sie in der „Kastalischen Quelle“ schon benannt und beschrieben wurde. Hier steht sie frontal zum Betrachter, der äußere Habit einer klassische Griechin erscheint wie unter einer Milchhaut. Das Bild entstand im Tempelbezirk von Delphi und hat deshalb den Namen, weil in dieser Darstellung Delphi selbst Gestalt gewinnt.
Delphi lag für rund 1500 Jahre unter der Erde, der Ort wurde von dem deutschen Forscher Ulrichs entdeckt und seit 1892 von französischen Archäologen ausgegraben, die dafür das Dorf Kastri abtragen ließen. Das Dorf wurde in unmittelbarer Nachbarschaft neu aufgebaut und ist heute eine kleine Stadt, die vom Tourismus lebt.
Wenn man durch die teilweise wiederaufgebauten Reste des Tempelbezirkes geht, mag man sich das antike Delphi vorstellen können: das Schatzhaus der Athener, der Tempel Apollons, die harmonisch in den Felshang gelegten Wege...
Fermor* imaginiert das antike Delphi so: "...ochsenblutrot, tiefblau, ocker und...Heere polychromer, schwarzäugig starrender Statuen" die "von goldenen Ornamenten strotzten. Das Innere der Tempel war finster und geheimnisvoll, dunkler Rauch schwärzte die riesigen Elfenbeinstatuen. Diese waren in Purpur gehüllt, trieften vor Honig und Wein und glänzten von Öl und Blut, währen der Dampf von Tierleichen und verbrennendem Fleisch das Stockdunkel erfüllte. Nicht nur die Götter des Olymps, sondern auch die sinistren chthonischen Dämonen hielten sich in jenen Gehegen auf."
Man mag sich Delphi auf verschiedene Weise ausmalen können: fest steht, daß es für seine Funktion die Jungfrau brauchte. Jungfräulichkeit als biologischer Zustand ist in diesem Bild eben nicht das Unberührte, sondern im Gegenteil: die Frau ist eine Berührte, die still hält im Zweifel, mit wem sie da in Kontakt ist - und die sich aufrichtet im Wissen, von nun ab eine Gezeichnete zu sein.
Manchem Leser mag der abschließende Gedankengang weit abgelegen erscheinen, aber es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß es die Griechen waren, die im Sternenhimmel Abbilder irdischen Geschehens sahen und den Sternbildern Namen gaben.
Im Jahreslauf entspricht die Jungfrau dem Zeitpunkt der Ernte - und sowohl bei Robert de Boron als auch bei Chretien de Troyes kommt der junge Held aus einer Ackerbaukultur. Bei Wolfram von Eschenbach ist das etwas anders: er ist genauer und gibt in seinem Epos immer wieder einmal Hinweise auf die Handlungszeit, indem er astronomische Konstellationen nennt, deren astrologische Entsprechung stets korrekt ist.
Warum das so ist, muß an späterer Stelle erläutert werden. Die Entstehung der Gralsepen fällt zeitlich gesehen mit dem Bau der großen gotischen Kathedralen zusammen, die zu Zentren der Jungfrauenverehrung wurden.
Um die Grundlagen für den enormen technischen Innovationsschub, den die Gotik mit sich brachte, ist viel gerätselt worden. Woher kamen plötzlich all die klugen Baumeister mit ihrem soliden Wissen um Statik in dieser Zeit, als doch die Brückenbaukunst der Römer in Vergessenheit geraten war?
Während meiner Recherche zum Gral stieß ich in Heinrich Teutschmanns Buch „Der Gral - Liebe und Weisheit“ auf eine phantastisch klingende Erklärung, derzufolge ein Athener Ratsherr, eingeweiht in die eleusynischen Mysterien, vom Apostel Paulus gelegentlich seiner Predigt auf dem Areopag (traditioneller Ort der Athener Rechtsprechung) bekehrt und nach Paris geschickt worden sein soll - den Bauplan für diese Kathedralen in der Tasche.
Und noch phantastischer: der Grundriß zum Bau der Kathedralen entspricht dem Sternbild der Jungfrau. Die räumlichen Maße hätten die Funktion, eine magische Korrespondenz zwischen den Gläubigen und den Kräften dieses Sternbildes herzustellen.
Einen ähnlichen Sinn hätten auch die Ausrichtung mancher pharaonischen Pyramiden nach dem Sirius im Sternbild des Großen Hundes.
Damit hatte ich einen jener spekulativen Räume betreten, in denen man sich nur eine Weile geduldig aufhalten muß, um irgendwann plötzlich auf einer Schwelle zur Erkenntnis zu stehen.
Als ich mit Edith Tar über meine Entdeckung sprach, sagte sie: "astrologisch hat die Jungfrau als Motiv die Aussteuerung - sie repräsentiert die Fähigkeit, eine Gratwanderung ohne Absturz auszuführen. Gleichzeitig ist die Jungfrau das Ausübende des Schützen, und das Motiv des Schützen ist die Religiösität"***.
Vielleicht baute Areopagitos eine Brücke von der magischen Welt zur Welt der Bewußtheit, ohne dem Volk seinen herkömmlichen Bezugsrahmen zu zerstören. Die magischen Aspekte des religiösen Lebens wurden sozusagen abgesenkt in den Grundriß, das Schwingungsgefüge blieb erhalten, und die Personifikationen der Naturreligion nahmen in einigen wichtigen Fällen die Gestalten christlicher Heiliger an. Die Menschen fühlten sich in ihrem Glauben nicht beraubt, sondern beschenkt, denn es wurde nun allmählich möglich, einer chthonischen Fernsteuerung zu entkommen und sich hinzubewegen zu individueller Bewußtheit (Christus).
Diese Bewußtwerdung hängt in vielerlei Hinsicht eng mit der Jungfrau im kalendarischen wie im Wortsinn zusammen, denn mit ihrer Mutterschaft verliert zwar die Frau ihre Jungfernschaft, aber sie pflanzt gleichzeitig neues Leben in die Welt. Sie kann die Schöpfung am eigenen Leib erfahren und ihrem Kind in dem Gefühl aufwachsen lassen, daß es unmittelbarer Teil der Schöpfung ist. Der so aufgewachsene Mensch wird in seiner Mutter die eigene potentielle Göttlichkeit verehren, denn im Prinzip ist jede Frau eine Brücke zu Gott - egal, ob die Spaghetti der Nachbarin besser schmecken.
Auf dem Konzil von Ephesos 431 n.C. wurde Maria zur Gottgebärerin erklärt. Diese Art theologischer Mutterschutz erlebte im 12. Jh. und später wieder im Barock einen kultischen Auftrieb, der sich in Literatur, Architektur und Malerei niederschlug. Und erst 1854 dogmatisierte Papst Pius IX. die seit dem Konzil vom Ephesus festgeschriebene Lehrauffassung der Kirche, daß Maria ihr Kind im Stand der Jungfräulichkeit empfing.
Die Kinder, die jene Pythia von Delphi empfing, waren Worte, die aufwuchsen in Taten.
*Fermor: „Mani“ (S. 318)
** Heinrich Teutschmann "Der Gral (Weisheit und Liebe)", dessen Erstfassung 1959 erschien und das ich in einer Ausgabe von 1984 las, sowie des Buches von Malcolm Godwin "Der Heilige Gral (Ursprung, Geheimnis und Deutung einer Legende)" 1994
***Edith Tar in einem Gespräch 1994
8.9.97
 Stufen/Dephi
Stufen/Dephi
Das Bild gehört zum Delphi-Zyklus und zeigt eine Treppe, die steil und gerade nach oben führt, ohne daß der Betrachter etwas darüber erfährt, wo diese Treppe beginnt und wo sie endet.
Wer schon einmal ein antikes Stadion besucht hat, mag den Ort erahnen; aber die Entschlüsselung der Lokalität entschlüsselt nicht das Bild, an dessen unteren Rand das Gesicht einer Frau zu sehen ist.
Die Frau liegt offenbar auf den Stufen, die aus behauenen ganzen Steinen gefügt sind; aus den Fugen wachsen hier und da Pflanzen.
Die Augen der Frau schauen wach in den Himmel, beobachten, fixieren aber nichts. Der Ausdruck dieses Gesichtes ist weder teilnahmslos noch abwesend; ihn als entrückt oder eingekehrt zu bezeichnen, wäre unzutreffend, eher ist es ein Ausdruck wertfreier Erwartung.
Mehr als alle anderen Bilder der in Griechenland entstandenen Serie baut dieses eigenwillige „Stufenportrait“ eine Brücke zwischen der für Europa bestimmend gewordenen Geschichte der griechischen Klassik und den Legenden um den Gral.
Entscheidend für den Brückenbau ist die Tatsache, daß die abgebildete Treppe weder Anfang noch Ende hat, denn damit rückt die Treppe aus dem Bereich reiner Funktionalität in den der Symbolik. Stufen symbolisieren ganz allgemein Aufstieg oder Abstieg: egal, in welche Richtung man sich bewegt, es handelt sich immer um das Herstellen einer Verbindung zwischen Oben und Unten.
Es gibt eine etymologische Deutung des Wortes Gral, die auf einer Ableitung vom lateinischen gradualis beruht, was dann soviel wie „von Stufe zu Stufe“ oder „stufenweise Entwicklung“ heißt.
Auf eine solche Interpretation ist bei den Autoren des 12 Jh. kein Hinweis zu finden. Wolfram von Eschenbach beschreibt den Gral als Stein, auf dem auf wundersame Art der Name desjenigen erscheint, der zum Dienst am Gral berufen ist, wobei der Gral selbst ein außerordentlich dienstbares Medium ist, denn er nährt, heilt, hält jung, gibt Weisheit und Frieden. Über die Herkunft dieses Wunders sagt Wolfram nur: „es ist ein Ding am Himmel, das wird genannt der Gral“.
Stein und Stufe bilden ideell die austauschbaren Anfangs- bzw. Endpunkte der Treppe, wobei der Stein Trittsicherheit und die Stufe Bewältigung bedeutet.
Beides - sicheres Gehen und Bewältigung der Stufe - steht in einer Wechselwirkung im Menschen, der sich seines Reifens bewußt wird.
Anfang und Ende der Treppe befinden sich stets dort, wo sich der Mensch befindet.
Für den Betrachter mag es ein zusätzlicher Reiz sein, daß er im Portrait der Frau auf den Stufen die Frau von der kastalischen Quelle - die „Pythia“ - wiedererkennt: die Stufen der Entwicklung sind in einem Leben nicht zu überspringen, aber im Menschen selbst ist jede Stufe latent.
Dem Bild ist das Gedicht „Das Lachen am Ende der Treppe“ zugeordnet.
9.9.97
Schwarzer Engel von Santorin

„Körperlos jagen sie mit den Stürmen,
Theras & die Blüten von seinem Stamm,
jagen von einem unbehausten Ort zum nächsten
& werfen ihre Speere nach der versunkenen Insel.“
Ein Novembertag im Jahr 1994 auf der griechischen Insel Santorin: Wind reißt an Fensterläden, faucht durch Gassen und inszeniert einen von schroffen Gegensätzen geprägten Dialog zwischen Licht und Schatten, die himmlische Szenerie wechselt abrupt von Schwarzblau zu Schlaglicht, von Schlaglicht zu gedämpftem Grau.
In diese atmosphärische Substanz tritt eine Figur, die gegen den Wind schreitet und die Horizontlinie bricht: der „Schwarze Engel von Santorin“.
Unter diesem Titel sind die Bilder zusammengefaßt, die an diesen Novembertag entstehen sollten und sämtlich das Motiv des Hauses variieren.
Die See ist stürmisch, die Ankunft der Fähre nach Kreta steht in Frage, der Flugverkehr nach Athen ebenso; vielleicht müssen Touristen abwesend, Tavernen und Souvenirshops geschlossen sein, damit ein Engel ins Bild treten kann?
Ich sehe unser Behaustsein wie Gischt zersprühen im Einbruch einer Außenwelt, die sich in den Elementen äußert. Ein Zustand der Gefährdung, in welchem der Sinn des Bleibens notwendigerweise zu einem Akt des Einwohnens wird.
Im Mittelpunkt des Bildes steht ein weiß gekalktes Haus, dessen Architektur von ausgeklügelter Schlichtheit ist. Jeder Zierrat fehlt. Luken, Fenster und Türen sind dicht geschlossen. Die Terrasse, die an anderen Tagen vielleicht zum Wäschetrocknen genutzt wird, ist dem Meer abgewandt und bietet somit Schutz vor dem Seewind. Hof, Terrasse und Dach sind über zwei Treppen verbunden, ein Schornstein gibt dem baulichen Gefüge eine Mitte.
Das Haus fügt sich in das Farbspiel ein und wird ihm zum Fundament, auf dem der „schwarze Engel von Santorin“ erscheint.
Wieso wird die Figur von der Bildautorin als Engel bezeichnet und mit dem Ort in Verbindung gebracht?
Sicher hat die Bildwirkung die Titelwahl beeinflußt: die Fotografin ist schon oft gefragt worden, wie sie denn dies oder jenes Bild „hinbekommen“ hat und welcher technischer Tricks sie sich bei der Umsetzung einer Bildidee bediente. Ihre Antwort lautete dann meist: „das haben meine Engel gemacht“. Edith Tar versteht Engel als Boten zwischen einer geistigen und einer stofflichen Welt; daß einer dieser Boten in einem ihrer Bilder schließlich „erscheint“, hat sie dann doch verblüfft, insofern sie eine derartige Wirkung ihrer Inszenierung nur hoffen konnte. Andererseits wird im Titel ausdrücklich der Ort genannt, dessen Geschichte im Bild mitschwingt.
Santorin ist die südlichsten Insel in der Kykladengruppe. Im griechischen heißt die Vulkaninsel Thera, die Wilde, benannt nach einem Achäer, der um 1900 v.C. die Insel mit seinem Gefolge besiedelte. Der Name Santorin geht auf italienische Kaufleute zurück, die sich mit dieser Namengebung des Schutzes der St. Irene versichern wollten. Die braven Kaufmänner hatten sich vermutlich nicht die Mühe gemacht, in antiken Aufzeichnungen nachzulesen, denn dort wird die Insel Kalliste (die Schönste) oder Strongyle (die Runde) genannt. Rund ist diese Insel aber schon lange nicht mehr, denn um 1530 v.C. wurde sie durch einen Vulkanausbruch auseinandergerissen. Seitdem hat es auf der Insel immer wieder Erdbeben gegeben, zuletzt 1956.
Als ich am über 90 m steil ins Meer abstürzenden Rand der Insel stand und auf die Caldera sah, beschlich mich eine merkwürdige Assoziation. Plötzlich erschien mir der Anblick dieser riesigen schwarzen Schale voll Meerwasser wie ein natürlich entstandener Gralskelch.
Etwas von dieser Assoziation spiegelt sich für mich auch in diesem Bild: etwas Phänomenhaftes, dessen Wirken sich in Einbrüchen vollzieht und das selbst aber gestaltlos bleibt.
Die Katastrophe von 1530 v.C. vermerkt die griechische Mythologie als die „Flut des Deukalion“, eine Variation zum biblischen Noah. Noah landete auf dem Ararat, das griechische Pendant dazu heißt Parnaß, an dessen Fuße Delphi liegt. Diese Parallele erlaubt eine Rückkopplung zwischen den in Delphi entstandenen Bildern und jenen, die einige Wochen später auf Santorin gemacht wurden
Der griechische Archäologe Spyridon Marinatos, der 1974 bei Ausgrabungen auf Santorin ums Leben kam, hat einen Zusammenhang zwischen dem Vulkanausbruch auf Santorin und dem Untergang der minoischen Kultur auf Kreta hergestellt; und wie eng die hellenische mit der minoischen Kultur verknüpft war, illustrieren nicht nur die Überlieferungen um Dädalus, Ariadne und Theseus.
Der „schwarze Engel von Santorin“ könnte aber auch ein Elohim sein, der auf eine andere Annahme verweist, derzufolge der Vulkanausbruch von Santorin zeitgleich mit dem Auszug der Hebräer aus Ägypten stattgefunden hat, die vom Lande Gosen im Nildelta durch das Schilfmeer gezogen sein könnten. Diese Annahme würde jedenfalls die geophysikalische Erklärung untermauern, mit der gelegentlich die Teilung der Wasser interpretiert wird: durch die Flutwelle könnten die Wasser des Nildeltas abgesaugt worden sein, um nach wenigen Stunden wie in einem Ausatmen des Meeres zurückgedrängt zu werden.
An dieser Schnittstelle zwischen mutmaßlich irdischen Tatsachen und geglaubten geistigen Wirklichkeiten treten die „Engel“ auf.
Ob man sich die Mühe macht, einen Engel zuzuordnen in eine der drei großen Hierarchien des Dyonisos Areopagitos; ob man, wie Reiner Maria Rilke, „der Engel Ordnungen“ beschwört oder, wie Jorge Luis Borges Gott bittet, „daß am Ende meiner Tage ich den Engel nicht entehre“: Engel sind für die, die ihnen begegnen, Boten einer geistigen Ordnung.
Daß gegenwärtig Begegnungen dieser Art eher selten bezeugt werden, hat möglicherweise seinen Grund in einer gewissen Bedürfnislosigkeit hinsichtlich solcher sublimer Strukturen.
Engel gelten heute als nicht sichtbar, sie verkörpern ganz unkörperlich Prinzipien der Schöpfung, mit deren Evidenz sie kaum noch in Zusammenhang gebracht werden.
Wir haben ein eigenes System zum Verständnis einer Welt entwickelt, die wir zunehmend als selbsterschaffen betrachten. Und der Mensch selbst könnte in absehbarer Zeit ein durchaus hausgemachtes Wesen sein: geklont. Aber damit wäre der Mensch dann weder den Engeln gleich - denn die stürzen von innen nach außen - noch Gott, dem ein Sturz nur freier Fall in seine Eigenschaften ist; die Menschen ersetzen die Engel, die sie für abwesend halten, indem sie deren Allkraft nachempfinden, ohne deren Gespür für Zurückhaltung zu besitzen.
Der Engel von Santorin schreitet über das Dach eines Hauses. Für mich ist dieses Schreiten wie das Einschreiten in die Gegebenheiten einer Welt, die sich selbst genügt, die sich ein Zeitmaß zur Ausblendung der Ewigkeit erschuf und bei sich verweilt wie ein Rentner, der aus dem Fenster hinabschaut auf eine Autobahn, die mitten durch sein Grundstück führt.
20.1.98

Wache vor Lît marveile
Das Bild bezieht seine eigenartige Strahlkraft aus der Farbkomposition von leuchtendem Rot und tiefen Schwarz. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Mischung aus der Lust am Mondänen und am Exzentrischen: eine Frau schaut mit weit offenen Augen auf den Betrachter und verleiht der Szenerie etwas Theatralisches. Betrachtet man den Augenausdruck der Frau etwas länger, bemerkt man, daß ihr Blick nicht wirklich auf einen Betrachter gerichtet ist, vielleicht eher auf einen Vorgang, über den das Bild selbst nichts mitteilt, der sich nur in den Augen widerspiegelt. Man fühlt sich als Betrachter von diesem Blick nicht gemeint und könnte die Exaltiertheit des Ausdrucks als ironische Brechung des Dargestellten interpretieren, wenn sich der Kontext aus dem hier Sichtbaren erschließen würde. Dieser Kontext bleibt im Bild selbst verborgen, aber der Titel liefert eine Brücke, auf die später noch eingegangen werden soll.
Die Frau sitzt auf einem Sofa, das vor einem großen Bett steht, dessen geraffte Vorhänge irgendwie auch an eine Bühne erinnern, das florale Tapetenmuster erscheint als Teil einer absichtsvollen Dekoration.
Die Proportionen innerhalb des Bildes sind ausgewogen und werden doch durch einige Details gespreizt und überzogen. So wird der Eindruck der ungewöhnlich großen Schlafstatt durch die Plazierung der Frau in der exakten Bildmitte überhöht, während die lockere Körperhaltung der Sitzenden durch die nach innen verrenkte Fußstellung eine innere Gespanntheit verrät, die dem fast monumentalen Bildgefüge etwas szenisches verleiht: man ahnt, daß hier etwas geschieht, und die sitzende Frau nimmt an diesem Geschehen irgendwie teil.
Das Bild entstand 1992 in einem walisischen Castel, das als Hotel dient, und steht als Fotoarbeit am Anfang der Bilder, die zum Thema „Wurzeln Europas“ später entstehen sollten. Es zeigt mehr als andere Arbeiten die Lust der Fotografin am Spiel mit Situationen, mit Formen und Farben. Aber auch hier ist das Spiel bereits soweit getrieben, daß der Betrachter aus dem Arrangement der Einzelheiten auf eine bewußte Inszenierung schließt.
Der Bildtitel verweist direkt auf Wolfram von Eschenbachs Epos „Parzival“, und zwar auf eine Episode am Beginn des elften Buch, in dem Parzivals Alter Ego Gâwân ein seltsames und gefährliches Abenteuer in Clinschors Schastel marveil zu bestehen hat.
Im Zauberschloß gibt es ein Wunderbett namens Lît marveile, über das Wolfram urteilt: „Wer es sich bequem machen möchte, der gehe lieber nicht in solch ein Bett: Es wird wohl niemand behaupten, dort würde viel Komfort geboten“.
Und das Bett selbst beschreibt er so: „Es lief auf vier Rädern, runden Scheiben aus schimmernden Rubin, und es lief schneller als der Wind. Die Bettfüße waren gegabelt über den Rädern.“
Gâwân gelingt es zunächst nicht, in das wie wild umherfahrende Bett zu steigen, daß vor ihm Haken schlägt wie ein Hase. Als er sich in Gedanken dafür entscheidet, es mit einem Sprung zu erobern, bleibt das Bett vor ihm stehen, und er kann sich hineinlegen. Aber da beginnt das Abenteuer erst richtig: “Mit ganz unerhört wildem Feuer ging das Bett durch, da schoß es hin und dort: keine von den vier Wänden ließ es aus, gegen alle rannte es an mit Macht, daß die ganze Burg davon erdröhnte.“
Der Vorgang ist von solch elementarer Wucht, daß Wolfram ihn folgendermaßen kommentiert: „Wenn man alles Donnern vom Anbeginn der Welt zusammennähme und dazu sämtliche Trompeter, vom ersten bis zum letzten, in dies Zimmer täte und wenn sie dann bliesen, wie sie es tun, wenn sie es bezahlt kriegen, dann könnte da der Lärm nicht größer sein“.
Die Vorstellung vom Bett, das herumrast, anstatt Ruhe und Schlaf zu geben, ist eine Allegorie auf die Eigendynamik der menschlichen Vorstellungswelt, in der es weder Ruhe noch Schlaf gibt, weil sie jedem Impuls folgt, der aus ihr selbst aufsteigt.
Kurz gesagt: der unmittelbare Trieb ist König dieser Welt der Vorstellung, in der die Wirklichkeit solange verdrängt und überlagert bleibt, bis die Vorstellungswelt als Gespinst erkannt wird und sich aufgelöst.
Gâwân besteht dieses Abenteuer, weil er an seiner Wirklichkeit festhält, obwohl alles, was ihm widerfährt, nicht nur dagegen spricht, sondern auch seine Wirklichkeit als Einbildung erscheinen läßt: die Steine, die auf ihn geschleudert werden, während Lît marveile mit ihm macht, was es will, sind richtige Steine, und die Pfeile, „abgespult“ aus fünfhundert Armbrüsten, durchschlagen wirklich seinen Schild und fahren durch die Ringe seines Panzers. Und als ihn schließlich ein hungriger Löwe angreift, muß er wirklich mit ihm um sein Leben ringen.
Was ihm widerfährt, ist höchst unwahrscheinlich, und doch geschieht es, denn er hat sich auf einen Kampf mit seinen Projektionen eingelassen, der seine Wirklichkeit auf den Prüfstand stellt.
Im Bildtitel wurde bewußt auf den Artikel verzichtet, so daß offen bleiben muß, ob es sich um die Aufforderung handelt, vor Lît marveile zu wachen, also wach zu bleiben und nicht den aus dem Unbewußten aufsteigenden Bildern zu folgen, oder ob eine Wache vor Lît marveile gemeint ist, die durch die sitzende und überwach auf den Betrachter schauende Frau repräsentiert wird.
Die Unklarheit ist ein Teil des Spieles, das aus den Form- und Farbkompositionen hinüberführt in ein Abenteuer, wie es oft in banalen Situationen beginnt und in existentielle Auseinandersetzungen mündet.
Im Bild „Wache vor Lît marveile“ geschieht das mit jenem Augenzwinkern, mit dem sich Zauberer untereinander verständigen.
Übrigens: Gâwâns Abenteuer endet mit der Befreiung der Frauen, die Clinschor auf seinem Schloß gefangen hält, und sie danken es ihm, indem sie den wunden Helden gesund pflegen, allen voran die alte Königin Dictam, König Artus Mutter, die ihre Heilkünste von Cundrie gelernt hat: „eine Wurzel legte sie in seinen Mund, da schlief er sofort ein; fürsorglich deckte sie ihn zu“. Möglicherweise verfolgt die Frau auf dem roten Sofa diese Szene, die sich vor ihren Augen in Clinschors Schastel marveil abspielt.
Zitate: Wolfram von Eschenbach „Parzival“, aus dem Mittelhochdeutschen von Peter Knecht, Eichborn Verlag Frankfurt am Mai 1993, Seiten 322-323/328.
9.8.97
Die Geschichte eines Augenblicks
Ein Mann liegt ausgestreckt auf dem Rücken, die Arme im Nacken verschränkt, die Augen geöffnet.
Über den Ort, an dem sich der Mann befindet, teilt das Bild kaum etwas mit; die Fotografin hat ihn zugunsten der Konzentration auf das Geschehen nicht in den Fokus genommen und beschränkt sich auf Andeutungen: die Agave über dem Kopf des Mannes, die undeutlich wahrnehmbare Pflanze links neben ihm und der Stein über der Schulter – genug allerdings, eine mediterrane Umgebung zu vermuten.
Daß sich in dieser Umgebung das Geschehen als unerschütterliches Nicht-Geschehen darstellt, kolportiert auf den ersten Blick mitteleuropäische Klischees über sorgenfreies Dasein in südlichen Gefilden, entfaltet aber auf den zweiten Blick ein kommunikatives Dreieck zwischen der fotografierten Person, der Fotografin und dem Betrachter des Bildes, dessen Vibration in einem Mix aus übergroßer Nähe und schwer bestimmbarer Distanz gründet.
Offenkundig hat der Mann nicht nur geduldet, fotografiert zu werden, es war ihm möglicherweise gleichgültig. Gleichgültig nicht in jenem trivialen Sinn, der das Gültige mit dem Gleichen in einen Topf wirft, sondern im Wortsinn, der auf die Analogielehre verweist, nach der noch Johannes Kepler seine „Weltharmonie“ entwickelte. Im digitalen Zeitalter, das nach Null und Eins rechnet, mag das anachronistisch scheinen; in Wirklichkeit setzt das analoge d.h. vergleichende Denken das Potential authentischer Individualerfahrungen im Kontext kollektiver Erfahrungsmuster frei. Die Fotografin weiß das. Sie kommt nur dann in die Nähe ihrer Intention, wenn sie während der Arbeit zu ihrem Gegenüber, dem temporären Modell, einen tiefen Bezug aufbaut. Ein Bezug, der sich innerhalb weniger Sekunden über einen Blickkontakt herstellt, der manchmal aber auch lange Vorbereitungszeit, tastendes Umrunden und Phasen der Abwendung braucht. Hier diktieren die Erfahrungen, die Edith Tar als Portraitfotografin gemacht hat, den Qualitätsbegriff, der die menschliche Überein-kunft zwischen zwei Personen braucht. Kein Foto von Bestand entsteht ohne die Übereinkunft, den die Künstlerin wie einen Laserstrahl auf ihre Absichten zu richten weiß: Das Persönliche sucht sich seinen Ausdruck, bis es vor seinem metabolischen Spektrum bestehen, ihm eine Mitte und dem Werk eine weitere Resonanz hinzufügen kann.
Der ruhende Mann mag die Bildvorstellungen der Fotografin erfaßt und damit transportiert haben. Seine zwar offenen Augen verraten keine Reaktion. Das verstärkt die Ausstrahlung der Ruhe, in die er sich begeben hat. Diese Ruhe ist der eigentliche Ort, an dem er sich befindet, und dorthin ist ihm Fotografin gefolgt: Ein suggestiver Kokon umgibt beide, das Surren der Kamera bleibt unhörbar, kein Klicken bricht den Zauber.
Eigenartig: Aber gerade hier, wo die Geschichte eines Augenblickes, der sich zwischen der Fotografin und ihrem Gegenüber entfaltet, sich selbst genug sein könnte, beginnt das Bild ein Eigenleben. Der Mann, der keine Notiz von der Fotografin nimmt, und so gar keine Rolle zu spielen bereit ist, wird im Bild dennoch zum Protagonisten. Die Projektionsmuster, die das Bild bedienen könnte, perlen ab.
Das Bild ist lesbar als ironischer Kommentar zu den Tableau Vivants der Goethe-Zeit; einer Kunstform, die von Zitaten lebte, die bis in das Arsenal pathetischer Gesten und idealer Körperdarstellungen zurückreichen, wie sie in den antiken Plastiken zuerst formuliert wurden.
Der Mann, der keine Rolle spielt, sich jeder Rolle verweigert, erweitert das Spektrum der Projektionen um den Aspekt der Uneinordenbarkeit.
Die Agave am Kopfende des Mannes setzt nicht nur die von rechts unten nach links oben ansteigende Horizontale in einem Knick um, der die Linie des männlichen Körpers in eine Vertikale dreht, sondern erscheint als vignettenhaft verkürzte Darstellung eines Strahlenkranzes.
Läßt man diese Assoziation zu, ergibt sich eine Glorifizierung, die nur kurz aufscheint, um sogleich durch die bildimmanente Attitüde aufgehoben und in das milde Licht des Augenblicks gerückt zu werden. Aber nun ist sie da, diese Assoziation, und selbst wenn sie sujetbedingt entsorgt werden kann: Es reizt, den Gedanken zu verfolgen.
Die Agave als angedeutete Gloriole rückt die liegende Person in die Nähe des Schmerzensmannes. Er ruht aus. Die Abnahme vom Kreuz ist verwandelt ist eine fast intim wirkende Pose des Gelassenseins. Siesta und Erlösung fusionieren in einem Sinne, wie er im Wort All-Tag verborgen ist.
Der Augenblick wird plastisch im Sinne der Endgültigkeit, die das Foto stiftet. Und gleich wie bei einer Plastik läßt sich die Situation umrunden, ohne daß daraus der Stoff für eine Erzählung oder andere Formen weiter führender, das Bildgeschehen ergänzender Assoziationen ergibt; denn es geschieht nichts – das einzige, was sich ereignet, ist völlige Ruhe.
„Der Wunsch, ein optimales Bild abzugeben, weckt die Pose.“*
Aber jede Pose müßte die Ruhe, die das Bild ausstrahlt, mit Spannung aufladen, und würde somit Ruhe als reinen Zustand aufheben.
Der liegende Mann hat ganz offenkundig kein Interesse an einer Pose, und wenn sich im Bild ein Interesse an einer Pose im Sinne der Selbstdarstellung ausmachen ließe, dann nur im fotografischen Motiv selbst. Denn mit diesem Motiv formuliert die Fotografin ihren Begriff von Ruhe so beiläufig und absichtslos, daß sie als Schöpferin des Bildes kaum in den Verdacht gerät, ihre Absicht in einen schwer entschlüsselbaren Interpretationsrahmen gestellt zu haben. Im Gegenteil: mit dem Bild entschlüsselt die Fotografin einen Aspekt ihrer Arbeit, der durch das Forschen nach der Tauglichkeit des Mediums als Transportmittel geistiger Haltungen geprägt ist. Dieses hartnäckige Fragenstellen läßt keinen finalen Kunstbegriff zu und bezieht Vitalität aus der in der Fotografie immer wieder zu treffenden Entscheidung zwischen Pose und Schnappschuß.
Das Bild ist Übersetzung der starken Anziehungskraft, die ein Augenblick haben kann, der in sich die Fülle des Daseins trägt. Damit erreicht das Bild einen Grad der Selbstverständlichkeit, die den allegorischen Impuls überwindet. Anders gesagt. Das Wunderbare wird durch die Vorführung individueller Lebbarkeit aus dem Reich der Allegorie in die Wirklichkeit transformiert.
Stuttgart, 2002
* Zitat aus: „Tableaux Vivants – lebende Bilder und Attitüden in Fotografie, Film und Video“; Katalog zur Ausstellung in der Kunsthalle Wien, Mai bis August 2002, 239 S. (Autoren Sabine Folie, Michael Glasmeier) S. 206
Nibelungenlied

Eine Frau steht mit dem Rücken an einem Abgrund, dessen Bedrohlichkeit völlig absorbiert wird von der ausladenden Landschaft.
Allein der Höhenunterschied zwischen dem links im Bild stehenden Baum und jenem, der aus dem rechten Bildgrund mit seinem Wipfel aufragt, macht die mögliche Fallhöhe deutlich, die sich hinter der Frau auftut. Da sie nach vorn schaut, und wegen der sich hinter ihr auftuenden Ebene, erscheint das Bild zunächst einmal nur luftig und wie hingeweht - ganz im Gegensatz zum düstere Schwere suggerierenden Bildtitel.
Das Bild gehört zu einer Serie, für die Edith Tar Rahmen aus Stahlblech fertigte, in die sie Texte einbrannte. Diesem Bild ist das Gedicht „Nibelungenlied“ zugeordnet, das Zitat daraus lautet:
Von den Burgen weht der Purpur
Staub, er jeden Mund verbraucht
In den Sinfonien der Wunden
sind die Helden abgetaucht
Es handelt sich um ein ironisches Spiel mit Wortmarken wie „Burgen, Helden, Purpur“, betrachtet durch eine surreal geschliffene Linse. So ähnlich „funktioniert“ auch das Bild: Burg, Felsen, dunkler Tann und etwas schleierhaft Erhabenes lassen sich atmosphärisch leicht dem Thema Nibelungenlied zuordnen, auf den ersten Blick scheint also alles klar und eindeutig. Aber der Bildgrund erlaubt natürlich die Betrachtung komplexer Motive und Zusammenhänge.
Das Bild entstand 1993 oberhalb der Stadt Hechingen am Rande der schwäbischen Alb, die geologisch zum Jura gehört, entstanden im Mesozoikums, als Kiselschwämme und Korallen Riffe bildeten, der Archaeopterix über die Gewässer segelte und erste Schmetterlinge zwischen Farnen, Gingkogewächsen und Koniferen schimmerten.
Im Nordwesten fällt die etwa 200 km lange Alb auf 500 Meter steil. Der im Hintergrund sichtbare Berg des Zoller (855 m) war einst ein keltisches Heiligtum, das die Römer übernahmen, als sie die Gegend zum Schutz gegen die Germanen befestigten.
Die exponierte Lage sicherte dem Berg seine strategische Bedeutung, bis Napoleon die Vorwerke schleifen ließ. Ende des 19. Jahrhunderts ließ der Deutsche Kaiser den Stammsitz der Grafen von Hohenzollern wieder aufbauen. Kaum zwanzig Jahre später wurde der aus dem Hause Hohenzollern stammende Regent zum Schlußpunkt hinter der Geschichte des Deutschen Kaiserreiches.
In diesem Geflecht historischer Bezüge liegt der Grund für die Wahl des Bildtitels und der Bezug zum gleichnamigen Gedicht - es ist der Begriff, der wirkt, das Klischee, das reizt.
Erwähnt sei auch, daß die Frau, die hier Modell gestanden hat, die Tochter des letzten Leibarztes des Prinzen von Hohenzollern ist, und ihre Familie 1949 aus Kattowitz nach Hechingen übersiedelte.
Bekanntermaßen hat die abgebildete Landschaft nichts zu tun mit dem Siedlungsgebiet der historischen Nibelungen, jenem Volk der Burgunder. Dieser germanische Stamm siedelte zwischen Worms und Speyer und hatte dort um 400 n.C. einen Staat errichtet.
413 hatte ihnen Kaiser Honorius als Foederaten des römischen Reiches die Siedlungsräume bestätigt. 435 bereitete Aetius als oberster römischer Heermeister den Burgundern, die durch das Moseltal westwärts drangen, eine Niederlage und schuf damit die Voraussetzung für den Untergang des Burgunderreiches von Worms, als es im Folgejahr von Attila angegriffen und zerschlagen wurde. Die Ostburgunder gerieten unter hunnische Herrschaft, die verbliebenen Westburgunder wurden 443 von Aetius zur Verlegung ihrer Siedlungsgebiete an die Westseite des Genfer See gezwungen.
Nicht weniger interessant ist die Geschichte des Nibelungenliedes selbst, von den aus dem 12. Jahrhundert datierenden Texten über deren Bearbeitung durch Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) bis hin zur Ineinssetzung der Begriffe Nibelungen und Deutsch in Zeiten eines fanatischen Nationalismus.
Nebenbei bemerkt studierte der aus Holstein stammende Hebbel in Heidelberg, das ja nicht weit entfernt ist von Hechingen. Und vielleicht widmet sich ein Schriftsteller später einmal einer Variation des Themas „Nibelungen“, indem er zwei in Hechingen geborene Politiker der jüngeren Geschichte zu Protagonisten in einem Stück über Treue und Verrat macht: Markus Wolf, der Sohn des Kommunisten und Schriftstellers Friedrich Wolf, wurde in Hechingen geboren, und war lange Jahre der Geheimdienstchef im Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Damit war Markus Wolf das ostdeutsche Pendant zum ebenfalls in Hechingen geborenen Klaus Kinkel, der nach seiner Karriere im Bundesnachrichtendienst Außenminister der Bundesrepublik wurde.
Sollte sich ein Dramatiker des Stoffes annehmen, empfehle ich, zwischen den Akten Albert Einstein als Stehgeiger auftreten zu lassen, denn auch er ist mit Hechingen verbunden, meinetwegen mit der in diesem Fall angebrachten Einschränkung relativ; jedenfalls hat sich der musizierende Physiker einige Male in Hechingen aufgehalten, seine zweite Frau stammte aus diesem Ort.
Aber zurück zum Bild. Mir hatten sich Fragen aufgedrängt, die sich über ein Detail auf überraschend einfache Art beantworten ließen; eine Antwort, die ich weitab von der Fragestellung fand.
Warum steht die Frau mit dem Rücken zum Abgrund? Damit der einst strategisch wichtige Punkt mit der Burg in ihrer Armbeuge zu liegen kommt? Warum laßt sie sich so offenkundig vom Wind anwehen, der ihre Körperkonturen hervortreten und ein Tuch, das sie mit Fingerspitzen in der linken Hand hält, an ihr vorbeiwehen läßt ? Erinnert das Tuch nicht an einen blutgetränkten Schleier?
Diese Fragen entwickelten sich aus einer durch den Bildtitel ausgelösten Assoziationskette, die sich letztlich als nicht maßgeblich für das tatsächliche Bildgeschehen erwies. Irgendwann fiel mir nämlich auf, daß der hellrote Pullover, den die Frau trägt, eine sonnenhafte Farbfläche ist, die den visuellen Spannungsbogen ausmacht. Armstellung und Oberkörper der Frau bilden einen Winkel, der nach links offen ist. Zieht man die Spitze dieses Winkels in einer gedachten Linie weiter, dann weist die Winkelspitze direkt in den verschwimmenden Horizont.
Es ist demnach das Wechselspiel zwischen dem Mikrokosmos des gelebten Augenblicks und dem Makrokosmos der mitgedachten Geschichte, aus dem das Bild seine Wirkung bezieht.
Kein Zweifel, der gelebte Augenblick erweist sich als stärker und verwandelt die schwer erträglichen Dissonanzen des alten Nibelungenliedes in eine vergleichsweise einfache Melodie, die um so angenehmer klingt, als sie ohne allen Nibelungenwust auskommt.
So erscheint die Frau als Notenschlüssel zur harmonischen Komposition einer Landschaft, deren kollektive Metaphorik samt den historischen Bezügen benannt wird, ohne diese Landschaft in interpretatorische Ketten zu legen. Die Kettenglieder bleiben gedachterweise sichtbar, es sind historische, ideologische und romantische. Aber soweit ich sehen kann, bläst durch alle der gleiche Wind, auf fast schwerelose Art anschaulich gemacht durch die Frau, die sich diesem Wind gestellt hat.
Kaditzsch, 4.11.98
Die Schlacht von Alyschanz

Die Camargue bei Les-Saintes-Maries-de-la Mer an einem Septembertag 1995: vier Männer reiten auf weißen Pferden durch eine überschwemmte Landschaft. Der Himmel ist hoch, und die schwer schwebenden Wolken unterfüttern seine transparente Ferne mit einer gewissen Dramatik.
Die Bildkomposition kolportiert ein Sujet klassizistischer Schlachtengemälde, führt aber eine ganz unmilitärische Personage vor. Warum das so ist, kann über die Komposition entschlüsselt werden. Was dann noch offen bleibt, ist der Bezug zum Titel; aber dazu später.
Folgende Details fallen zuerst auf: erstens reiten die vier Männer in eine gemeinsame Richtung und bilden dabei ein Kreuz, zweitens steht in der Bildmitte Weiß gegen Schwarz - siehe die Oberbekleidung der beiden mittleren Reiter - und drittens ist der Reiter links außen als einziger dem Betrachter zugewandt. Wie er sich dem Betrachter zuwendet, läßt keinen Zweifel daran, daß er den Vorgang des Fotografiertwerdens verfolgt, sich dabei selbstbewußt präsentierend als einen Mann, der seinen Wert kennt und sich zu halten weiß. Die Zügel liegen locker in seiner linken Hand, in der rechten hält er einen Stock. Über diesen Mann wird der Innenraum des Bildes eröffnet: er, der das Zeug zu einem Anführer haben dürfte, ist im kleinen Troß der letzte Reiter.
Die Komposition basiert auf einer Winkelkonstruktion. Es sind zwei gleichschenkelige Linien, die sich zum Horizont hin öffnen und damit die eindrucksvollen Weite dieser Landschaft an der Rhônemündung in einer Art schildern, daß man ihre Luft einzuatmen glaubt.
Schauen wir uns die Linien des Dreiecks an: Linie A führt vom äußersten linken Bildrand, der von einem Haus markiert wird, direkt über jenen dem Betrachter zugewandten Reiter und trifft sich mit Linie B im Reiter mit dem weißen Hemd, der diese Linie durch eine Bewegung seines rechten Armes hinüberlenkt zu jenem Reiter mit schwarzen Hut und grüner Jacke, der in einigem Abstand und ohne sichtliche Hast voraus ist.
Linie C führt vom Reiter rechts außen direkt zurück zum Haus links außen und verläuft
parallel zur Horizontlinie. Interessant ist dabei, daß sich so unmerklich der Himmel in Richtung des Zieles verbreitert, in das die Reiter streben. Der beschriebene Winkel steht auf der Spitze und weist zum Betrachter.
Der Titel „Die Schlacht von Alyschanz“ stellt das Bild in Bezug zum Werk Wolfram von Eschenbachs, hier zu seinem Epos „Willehalm“, in welchem der Dichter ein Dreiecksverhältnis vor dem Hintergrund dieser Schlacht beschreibt. Historischen Quellen zufolge hat die Schlacht von Alyschamps nie stattgefunden. Hat sie aber doch, behauptet der Schweizer Autoren Werner Greub (vgl. Werner Greub: „Wolfram v. Eschenbach und die Wirklichkeit des Grals“, Dornach 1974), und zwar im 9. Jahrhundert während der Herrschaft Ludwigs des Frommen, dem Sohn Kaiser Karl des Großen.
Greub geht von der historischen Nachweisbarkeit der in Wolframs Trilogie geschilderten Ereignisse aus. Folgt man seiner Beweisführung, wird gerade die Tilgung dieser Schlacht aus den Chroniken zum Indiz für eine historische Dimension in Wolframs Werk.
Nun, bis zur Ausgrabung Trojas durch Heinrich Schliemann war kein Forscher auf die Idee gekommen, aus Homers Epen Rückschlüsse auf reale historische Ereignisse zu ziehen.
Schliemann war der erste Forscher, der einen Dichter beim Wort nahm. Er wurde erst belächelt, später aber mit der Bestätigung seiner Theorie belohnt. Seine Arbeit gilt heute noch als Mutmacher für Forscher, die von literarischen Überlieferungen ausgehen.
Alyschanz war ein Gräberfeld bei Arles, das vor den Römern bereits von Kelten und Ligurern benutzt wurde. Wolfram erwähnt im „Willehalm“ römische Sarkophage, die leer waren, und in denen man die gefallenen Christen und Moslime bestattete.
Einige dieser Sarkophage stehen heute noch in den Alyscamps, einer Allee in Arles, die zu den Touristenattraktionen der Stadt gehört. Geworben wird für Arles natürlich vor allem mit Vincent van Gogh, der 15 Monate in der Stadt lebte und auch die Alyscamps gemalt hat.
Gaugin, der befreundete Maler, schuf zeitgleich ein eigenes Gemälde der gleichen Ansicht,
unmittelbar nach diesem gemeinsamen Schaffenstag zerbrach diese Freundschaft in einem bis heute merkwürdig erscheinenden Streit. Wenige Tage später begab sich van Gogh in die Nervenheilanstalt des ehemalige Kloster von St. Rémy, wo er gestorben ist.
In Die Schlacht von Alyschanz verdichtet sich der Bildinhalt in der zentralen Achse, wo Schwarz neben Weiß steht: Konträre Farben, die auf die Dualität des Seins verweisen. Diese Dualität ist geschickt eingebettet in den Bildablauf und erscheint daher nicht als Konfliktpotential, das von Außen eindringt, sondern es ist im Innern des Geschehens anwesend.
Die vier Reiter sitzen auf Pferden, denen das Wasser bis zum Bauch reicht - hier deutet sich an, was mit Schlacht eigentlich gemeint sein könnte: das Auswägen der Tat und ihrer Folge, die in Konflikte führt.
10.8.97
Anhörung

Ein Mann steht am Ufer des Meeres, hält eine Videokamera in der Hand und wendet sich der Fotografin mit einer Drehung in den Hüften zu, die seine Körperhaltung verkantet und angestrengt wirken läßt. Das Meer wird von einem starken Wind aufgewühlt, der den Mann regelrecht auszuhebeln scheint. Der vom Wind geschliffene Sandstrand erinnert an erodierte Steppe. Am anderen Ufer ist eine Industrieanlage zu erkennen, dahinter verschwimmt eine weit entfernte Landschaft. Wir befinden uns an der französischen Mittelmeerküste, die fernen Berge sind die Ausläufer der provencalischen Alpen, Marseille ist nicht weit.
Ein Foto kann zwar nicht als ready-made bezeichnet werden, aber vielleicht doch sein Inhalt, wenn das Bild so unumwunden eine Bedrängnis artikuliert, die nicht mit dem sturmartigen Wind und dem aufgewühlten Meer erklärt werden kann, denn die Elemente sind zwar dominante Mitspieler, stellen aber keine Bedrohung dar.
Der Bildtitel „Anhörung“ sichert hier nicht den Interpretationsrahmen ab, sondern sprengt ihn auf. Gleichzeitig weist er in die Gedankenwelt der Fotografin, die längst „gesehen“ haben muß, was sie hier im Augenblick des Auslösens festgehalten hat, sonst hätte sie dieses Bild nicht finden können – deshalb die Parallele zum ready made. Gedankenwelt und Bildwelt befinden sich in Kongruenz und zeigen eine Bedingungsgefüge, in dem maximale Korrespondenz herrscht. Ich kann mühelos die thematische Nachbarschaft zu Bildern wie „Ende des kalten Krieges“, „Wache vor Lit Marveille“ oder „Der Weinberg“ sehen, wenn auch die Bilder formal und zeitlich weit auseinander liegen. Alle diese Bilder Edith Tars beschreiben im Kern Ablöseprozesse, ohne auf einen etwaigen Verlust in der Vergangenheit oder einen Gewinn in der Zukunft zu insistieren.
Die Künstlerin eröffnet mit dieser Art Bildern ihrem Denken einen philosophischen Wirkungskreis, der für Interferenzen offen bleibt. Diese Offenheit – oder sollte es besser Empfänglichkeit heißen? –ergibt sich aus ihrem Zweifel an den Positionen, die das Medium Fotografie zu diktieren scheint: dokumentarisch zu sein, realistisch, und dem im Fixierbad geltenden chemischen Gesetzen stets eingedenk. Der Zweifel am Medium und das Vertrauen in die Kraft des Bildes schafft kreative Freiräume, deren Vorzüge nicht erfahrbar sind, wenn nicht gleichzeitig auf Verbindlichkeiten verzichtet wird.
Die in den Bildern verarbeiteten Ablöseprozesse haben eine formale Entsprechung, die verständlich wird, wenn man eine Schublade mit der Aufschrift „plastische Fotografie“ öffnet. Die französische Philosophin Dominique Baqué nennt folgende Merkmale, die diese Art der Fotografie kennzeichnen: „Plastische Fotografie unterliegt einer gewissen ästhetischen Verweigerungshaltung und einer Zeitsuspension, ist großformatig, farbig, frontal und zeichnet sich durch eine kalte, trockene Strenge und den Verlust des barthesschen Punctums aus“.
Insofern wäre festzustellen, dass sich die Künstlerin der Fotografie bedient, um Bilder in den Raum zu stellen, die zwar stets etwas abbilden; aber im Kern sind diese Bilder vom Abbild gelöst, sie haben sich aus den Essenzen des Lebens aufgebaut und formulieren eine originäre Welt, in der die Fotografie nicht mehr Mittel der Vergewisserung ist, sondern ein Instrument zur Beschreibung der Übergänge zwischen verschiedenen Aggregatzuständen. Die Begriffswelt der Postmoderne scheint mir hier nicht zu greifen, denn die Postmoderne verneint die Möglichkeit individueller Spekulation ebenso wie die Inspiration der aus dem flüssigen Inneren der Tradition aufsteigenden Dämpfe. Edith Tar ist naiv genug, finale Theoreme nicht auf ihre Arbeit zu beziehen; und sie zeigt sich der Finalität allen Tuns verpflichtet, indem sie dem scheinbar Vorübergehenden einen Mittelpunkt abtrotzt.
Für mich ist das Bild Anhörung ein Beitrag zum Thema Paradigmenwechsel, den Leo Frobenius (1873-1938) als Übergang vom monumentalen Zeitalter zu einer uns bevorstehenden Erdkultur bezeichnet. „Alle früheren Zeiten kannten nur begrenzte Ausschnitte der Erdoberfläche...waren sozusagen alle insular, begrenzt. – Unser Schauen...überblickt das Ganze unseres Planeten. Diese Tatsache des Fehlens eines Horizontes“, folgert Frobenius, „ist ein Neues“.
Bezogen auf unser Bild kann man sagen: es bleiben genug Horizonte, die zur Überwindung einladen, ein Bewußtsein für „das Ganze unseres Planeten“ beginnt sich abzuzeichnen, wirklich ausgeprägt ist es noch nicht.
„Anhörung“ legt als Wort zweierlei nahe: einmal die Anhörung im Zeugenstand eines Gerichts, zum anderen die Anhörung im religiösen Sinne, wie wir sie aus dem Alten Testament kennen, wenn der Ruf Gottes an einen Propheten ergeht, der sich seinem Berufsbild entsprechend erst einmal verweigert. Man erinnere sich nur an Moses, der sein Volk durch die Wüste führen sollte und sagte: „Herr, nimm nicht mich, nimm meinen Bruder Aaron“. Moses fühlte sich seiner Aufgabe nicht gewachsen, aber letztlich wachsen wir den Aufgaben entgegen, und wenn jemand in sich hineinhört, wenn er sich anhört und zum Zeugen seines Tuns wird, kann er alles über sich und die Schöpfung wissen.
Für mich pendelt das Bildgeschehen zwischen Wissen und Fragen, ich fühle mich einbezogen.
Für mich ist die Videokamera in den Händen des Mannes nicht nur ein Werkzeug der objektivierenden Vergewisserung, es ist in diesem Kontext zuerst ein Symbol dafür, daß ich a) meinen Augen nicht traue und b) ortlos bin.
Was also ist mit dem Mann, der sich im Sturm an seiner Handycam festzuhalten scheint? Ich habe Edith Tar diese Frage gestellt, und sie sagte: „Die Person verkörpert den Zustand der Menschheit, die allmählich das Zuhören lernt – Zuhören auf das Abgespaltene, das Verdrängte, die Autre Monde. Das ist ein Ansatz zum dialogischen Prinzip, das sich auf alle Ebenen des Daseins bezieht und die Rolle, die wir in der Schöpfung spielen, neu formuliert.“
Wir schwiegen, dann sagte ich: „Das dialogische Prinzip beginnt mit einer Fusion, nie mit einer Spaltung“. Wieder eine Pause. „Ich sehe im Bild Anhörung die Beschreibung einer Krise, die mich aus allen Verankerungen reißt und mir nicht einmal die Skepsis als Halt läßt.“ „Und wenn wir in eine Krise geraten“, setzte Edith Tar den Gedanken fort, „reagiert unser System und verändert sich. In dem Moment ist es aus mit der metaphysischen Heuchelei".
Destillation
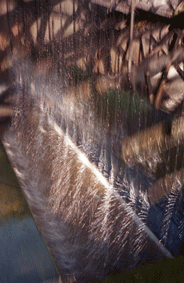 | |  | |  |
Triptychon "Destillation" | | Triptychon "Destillation" | | Triptychon "Destillation" |
Reinigung und Trennung meist flüssiger Stoffe durch Verdampfung und Wiederverflüssigung – das ist es, was das Lexikon über den Begriff Destillation aussagt. Was wird hier destilliert?
Wir sehen das Gesicht einer Frau, das aus dem Bildgrund aufscheint. Ihre Augen verraten Konzentration, Gefaßtheit, Ruhe und Aufmerksamkeit. Ein Gesicht, das dem Bildgeschehen eine Mitte gibt, die in sich abgeschlossen wirkt, während ringsum alles in Bewegung ist.
Was an diesem Triptychon besticht, ist zuerst die Genauigkeit des Details, dann der Verzicht auf einen sinnfälligen Zusammenhang. Heißt das, ein genaues Beobachten decodiert den Beobachter, nicht das Objekt seiner Beobachtung?
Bevor ich mich in Spekulationen stürze, zitiere ich Edith Tar, die mir sagte: „Das ist der Mensch, der sich von der Mechanik des Lebens befreit, und sein Leben wie einen Fluß anschaut“.
Im Bild selbst wird die Mechanik nicht vorgeführt, Edith Tar schraubt dieser der Bildidee innewohnende Reflexion auf eine Andeutung zurück, die sie zudem in ein spannendes Form- und Farbspiel verpackt: Die Schaufeln der Schiffmühle sind nur als Fragment zu sehen.
Mit der Zurücknahme des dokumentarischen Aspektes, der jeder Fotografie letztlich eigen ist, läßt sich an diesem Bild einmal mehr beobachten, wie virtuos die Künstlerin mit ihrem Medium zu spielen versteht, wenn sie bestimmten Gedanken Gestalt geben will.
Lange Zeit war der Begriff Destillation mit Alchimie verbunden, die heute gern als museumsreife Mutter moderner Chemie abgetan wird. Wie kurzgedacht das ist, hat unter anderem C.G.Jung dargelegt, der die Alchimie nicht nur zum abendländischen Kulturgut rechnete, sondern in ihr ein Sinnbild ganzheitlicher Prozesse erkannt hat. Und um nichts anderes geht es Edith Tar, die mit dem Bildtitel „Destillation“ das Interpretationsfeld absichtlich weit gesteckt hat.
Im Gesamtgefüge ihrer Arbeit kommt dem Triptychon ein besonderer Stellenwert zu, bildet es doch ein Brücke zwischen den der plastischen Fotografie verpflichteten Arbeiten und dem Genre der Portraitfotografie, deren Prinzipien die Künstlerin hier zitiert, ohne sie wirklich anzuwenden. Dahinter steckt kein Kniff, sondern eine gedankliche Vorarbeit, deren Umsetzung insofern als geglückt bezeichnet werden kann, als uns das Gesicht eben nicht viel über die Persönlichkeit erzählt. Dieses Gesicht ist offen und hat vor dem im Hintergrund kreisenden Rad eine beinah transparente Wirkung. Und obwohl sich der Blick in eine Seelenlandschaft öffnet, weist dieses Portrait über sich hinaus und hat etwas Gleichnishaftes. Es ist, als schimmere durch das marmoreske Gesicht etwas hindurch, was C.G. Jung das „höhere Selbst“ genannt hat. Die beiden Seitenflügel des Triptychons, die das Motiv des Wasserrades variieren, verstärken diesen Eindruck.
Wie sich der Umgang mit den Möglichkeiten der Portraitfotografie geändert hat, läßt sich nachvollziehen, wenn man den Foto-Text-Band „Die Spur des Anderen“ (1991) zur Hand nimmt, der eine Auswahl von Portraits enthält, die in den siebziger und achtziger Jahren entstandenen sind.
Ging es Edith Tar damals noch darum, die Individualität in ihrer Essenz zu erfassen und darzustellen, steht heute die porträtierte Person als Stellvertreter eines Prinzips im Mittelpunkt. „Jede Person kann sich in einer anderen wiederfinden“, sagt Edith Tar, und betont, daß es ihr um die Gesetze des Lebens geht, die zu erkennen die zentrale Motivation ihrer Arbeit ist. Insofern läßt sich ihre Arbeit nicht auf die Fotografie beschränken, wenn sie hier auch ihren stärksten Ausdruck findet.
„Destillation“ entstand während eines ersten Arbeitsaufenthaltes in der Denkmalschmiede Hoefgen im Herbst 1998, genauer gesagt auf der am Ufer der Mulde vertäuten Schiffmühle. Schiffmühlen dieser Art wurden bis zum Ausbau der Flüsse als Wasserstraßen zahlreich genutzt, heute sind sie vollkommen aus dem Landschaftsbild verschwunden. Die Schiffmühle von Hoefgen erinnert an diese heute fast vergessene Form der Energiegewinnung und bringt den alten Zusammenhang von Wasserkraft und Energie anschaulich ins Bewußtsein. Wenn man eine Weile in dem kleinen Holzhaus steht, dem gleichmäßigen Rhythmus des Wasserrades und dem monotonen Brummen der Generatoren zuhört, kann man Energiegewinnung als etwas Elementares erleben, das in direktem Zusammenhang mit der eigenen Nachttischlampe steht.
Die Fernversorgung mit Strom, an die wir gewöhnt sind, erscheint als real existierender Okkultismus, während die Energieerzeugung als solche den Zauber der ihr innewohnenden Idee offenbart. Und die fundamentale Idee dabei ist, die Herrschaft über die eigene Wahr-nehmung zu gewinnen. Das fängt bei der Nachttischlampe an, versetzt weitere Wünsche nach Erleuchtung in Schwingung und führt letztlich zur beunruhigenden Gewißheit, daß mehr Licht die Dunkelheit nicht abschaffen kann.
Als Edith Tar mit ihrem Modell auf der Schiffmühle arbeitete, habe ich diesen Prozeß mit der Videokamera dokumentiert, um Material für meinen Film „Die blaue Grenze“ zu sammeln. Während der Aufnahmen stand ich auf dem Steg und empfand die Umwandlung von Wasserkraft in Elektrizität als eine Art Zauberei. Mir wurde die poetische Dimension des Vorgangs bewußt, die der bloßen technischen Funktionalität einen metaphorischen Puls gibt.
Es ist dieser metaphorische Puls, der dem Triptychon eine Leichtigkeit verleiht, wie man sie vielleicht empfindet, wenn man sich innerlich von der Mühle des Egos gelöst hat, die uns mit Begierden, Wünschen, Zielen und einem unerschöpflichen Vorrat an Vorstellung auf Trab hält.
Eine Schlußbemerkung:. Die Lust am Durchkomponieren eines Bildes müßte nicht unterstrichen werden, das gehört zum Arbeitsprinzip der Fotografin. Aber im Fall des Triptychons „Destillation“ hat die gelungene Umsetzung der Bildidee auch einen Grund in der Begegnung Edith Tars mit der russischen Komponistin Tamara Ibragimowa, die für dieses Bild Modell gestanden hat.
Edith Tar hatte sich zuvor mit dem Werk der Komponistin beschäftigt, beide haben sich oft nächtelang über Kunst, Musik und Philosophie unterhalten. Die mentale und intellektuelle Nähe der beiden Frauen hat die Entstehung des Triptychons sicher befördert.
Hüter der Schwelle I/II
 | |  |
Hüter der Schwelle I, Leipzig 1993 | | Hüter der Schwelle II, Leipzig 1993 |
Ein auf dem Boden liegendes Stahlgerüst füllt die Bildmitte, in der ein Mann steht, dessen Gesicht auf dem Bild I nicht zu erkennen ist, während Bild II das Portrait des Mannes um so eindringlicher vorführt.
Ich werde mich in diesem Text auf Bild I beschränken, es bietet sich für einen Kommentar eher an als das Portrait (Bild II), das durchaus eigenständig betrachtet werden kann und soll, im Sinne der hier zu verhandelnden Inhalte aber eine Ergänzung bildet, die nicht näher erläutert werden muß.
Der Mann hat die Arme erhoben, hinter seinem Oberkörper liegt etwas von durchscheinendem Blau.
Der Titel legt nahe, daß der Mann mit dem „Hüter der Schwelle“ gemeint ist, bzw. daß es sich bei seiner Person um den Vertreter eines sonst nicht näher bekannten Berufsstandes handeln könnte.
Beides ist irritierend, denn erstens ist im Bild keine Schwelle auszumachen, die gehütet werden könnte, und zweitens wird dem Betrachter schnell klar, daß die Stahlkonstruktion einst ein Dach getragen hat und zu Boden gesunken ist. Der brandschwarze Boden läßt auch unschwer der Grund erahnen: der Mann steht in einem ausgebrannten Gebäude.
Die Fotos entstanden 1993. Bild I trägt die von Edith Tar in Stahl gebrannte Textmarke:
„Die Kinder künftiger Katastrophen jagen den Schutzmann nur um warm zu werden“.
Der Ort, an dem die Fotos entstanden sind, ist das ehemalige „Haus der Heiteren Muse“, das kurz zuvor ausgebrannt war - in Leipzig sprach man allenthalben von einer „heißen Sanierung“, eine Umschreibung von Geschäftspraktiken in den Grauzonen der Bodenspekulanten und Immo-bilienhändler.
Das Bild erlaubt eine doppelte Lesart: die eine bezieht sich auf den Ort selbst, der eng mit dem DDR-Fernsehen verbunden war, denn hier wurden die Unterhaltungssendungen wie „Ein Kessel Buntes“ aufgezeichnet, die Einschaltquoten für diese Show waren ungewöhnlich hoch. Es mutet wie Ironie an, daß der Ort für diese Aufzeichnungen im Bild als ein ausgebrannter Kessel erscheint.
Die zweite Lesart muß etwas komplexer ausfallen, weil sie auf einer zugegeben riskanten Assoziation aufbaut. Im antiken Jerusalem gab es tatsächlich den Berufstand eines „Hüters der Schwelle“, wie in Chronik 2./34 erwähnt: „Der König (Josia) gebot dem Hohepriester Hilkia....und den Hütern der Schwelle, daß sie aus dem Tempel des Herrn hinaustun sollten alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht waren“.
Aus dem hier vorgeführten (Musen-) Tempel ist nichts mehr „hinauszutun“, und das genau ist der springende Punkt, den der Mann in der Bildmitte im Sinne des Wortes verkörpert: der ausgebrannte Raum erzeugt dieses Wesen, das wie das personalisierte schlechte Gewissen des freilich abwesenden Publikums erscheint.
Dabei erinnert der Mann im Bild an einen ekstatischen Propheten, der seine Worte ungebärdig um sich schleudert. Ein Mann, der vergeblich ruft und warnt; und wenn er tobt, tut er das ebenso vergeblich. Kein klagender Mann. Keiner, der einen Verlust betrauert, sondern ein Zürnender.
Aber der ausgebrannte Musentempel kann kaum der Grund für einen solchen Zorn sein, eher spiegeln sich hier Empfindungen der Fotografin, die sich in der Metapher entladen haben. Wie sie selbst sagte, repräsentiert der „Hüter der Schwelle“ eine alte hermetische Tradition: “Das ist der zweigesichtige Janus, der in Vergangenheit und Zukunft schaut, und das ist der Saturn im Tierkreis auf 2° Fische, dem Punkt des Eingangs in das Totenreich, in das Verdrängte“.
Der „Hüter der Schwelle“ erscheint somit als Pendant zu einem Zeitgeist, der rücksichtslos die ihm jeweils passende Erscheinung annimmt, ohne sich darum zu scheren, was er gestern war oder morgen sein wird. Ob der Zeitgeist in einer Arena auftritt oder sich als elektrisches Signal durch digitale Netze bewegt, ist dabei ziemlich egal: dort, wo er sich wandelt, ohne je eine seiner Wandlung zu reflektieren, liegt die Schwelle.
Kaditzsch, November 1998
Promontorium Potestati

Der den Bildhintergrund dominierende Berg ist der Latemar. Die Felsformation liegt dem berühmten Rosengarten gegenüber und wird, im Gegensatz zu Laurins sagenumwobenen Refugium, von Touristen ebenso selten besucht wie von Bergsteigern. Bergführer warnen unerfahrene Enthusiasten davor, sich von der scheinbar leichten Zugänglichkeit des Latemar zu Kletterpartien verführen zu lassen, denn der Fels gilt als brüchig. Die Formation ist ein Zeuge vom früheren Grund des Thetysmeeres, auf seinen Höhen finden sich versteinerte Muscheln und Fossile urtümlicher Meeresbewohner.
Die Fotografin bezieht den Impuls für dieses Bild aber weder aus geologischen Phänomenen, noch aus jener für Louis-Trenker-Romantik bestens geeignete Kulisse der Majestät, obwohl es genau darum geht: Um das Befremdliche einer sich selbst genügenden Natur, die uns bestimmte Umgangsformen abverlangt, ohne uns das Gefühl zu geben, vollkommene Umgangsformen würden uns automatisch die Tore in den Palast ihrer Weisheit öffnen. Die Natur überläßt sich uns bereitwillig, um uns in den Rücken zu fallen, so daß wir uns umwenden und der eignen Ohnmacht ins Gesicht zu schauen. Damit haben wir ein Konfliktfeld betreten, das so alt ist wie das menschliche Denken. Die Fotografin hat es denkbar einfach markiert, indem sie den Berg als ein Werk der Natur in ein visuelles Wechselspiel zu einem menschlichen Werk stellt, wobei das menschliche Werk einen Berggipfel nachzubilden scheint. Das Rot dieses menschlichen Gipfels ist von marsianischer Intensität und wird in seinem Furor noch verstärkt durch die offenkundige Funktionslosigkeit des roten Gebildes.
Ich möchte darin zum ersten ein Gleichnis auf die Macht sehen, die gänzlich nutzlos ist, solange sie nur um ihrer selbst willen existiert und niemandem dient.
Die Heraldik der Herrscherhäuser des alten Europa über das antike Persien bis zu den ersten Stadtstaaten von Babylon zeigt sich von geflügelten Wesen vor allem deshalb übervölkert, weil selbst im Flachland der Adler Weitblick, Souveränität und Freiheit repräsentierte. Ein Symbolgehalt, der seine Bedeutung behält, obwohl die Herrscherhäuser längst dahin sind und die Freizeitindustrie eine Verbindung zwischen Wohnzimmer und Gipfel via Sessellift hergestellt hat.
Zum zweiten möchte ich in diesem Bild ein Gleichnis auf die Moderne sehen, die ihre Legitimität immer wieder aus ihrem Anspruch auf Freiheit von Bedeutung beziehen muß, um wenigstens eine Form der Abgrenzung von Traditionen zu entwickeln, auch oder weil sie sich letztlich aus ihnen speist, und sei es verweigernd.
Der lateinische Titel des Bildes erschließt sich mir als ein Hinweis auf die Wurzeln der politischen Strukturen Europas, die zurückreichen in die Gärten römischer Senatoren.
Die Fotografin hat das energetischen Feld dieses Ortes in ein Bild übertragen, das so faszinierend erscheint wie die Macht selbst. Machthaber und solche, die es gern werden wollten, haben schon im 19. Jahrhundert diese Berggruppe zur Bestätigung ihrer eigenen Majestät geschätzt. Kaiserin Sissi und andere, weniger berühmten Adlige residierten am Fuße des Latemar in einem mondänen Hotel, später zelebrierten auf den Almwiesen okkultistisch bewegte Nationalsozialisten altgermanische Rituale unter dem Vollmond. Nach dem Sieg der Alliierten entspannte sich hier am dunkel schimmernden Karersee Winston Churchill an der Staffelei und aquarellierte die Silhouette der Berge, die heutzutage rastlos durchstiegen werden von Herrn und Frau Jedermann.

Auferstehung
Ostersonntag in Llucmajor auf Mallorca, eine Prozession zieht durch die Gassen zur Kirche, voran die Blaskapelle, flankiert von Salut schießenden Männern. Wir stehen am offenen Fenster der Wohnung unseres Sohnes, schauen über die Dächer zum Meer und hören, wie der Wind die Trommelwirbel auflöst. Das ist die Situation, in der das Bild entstand, das mich in seinem Aufbau an Tafelbilder der Renaissance erinnert.
Das Bild gliedert sich in drei Teile, die auf jeder Ebene eine andere Korrespondenz mit dem Ostermotiv bilden. Auf der untersten Ebene sehen wir eine Vase, die leer ist. Blumen liegen auf dem Fußboden. Die langstieligen Calla wurden wohl aus der Vase genommen und legen eine Absicht nahe. Da diese Blume oft auf frischen Gräbern ab-gelegt wird, hier aber einer formal an das Sonnensymbol erinnernden Vase entnommen und auf den Boden gelegt wurden, kann ich die Ab-sicht nur als das Ende einer Totenklage deuten.
Die Komposition auf dieser unteren Bildebene hat etwas Schmerz-haftes, das sich in der Trennung von Vase und Blumen ausdrückt. Der Tod ist vorbeigegangen und hat das Leben in Ewigkeit und Augenblick getrennt. Es ist unbegreiflich und erschütternd, daß hier der Grund für die Erlösung vom Tod liegen soll. Die düstere Feierlichkeit des Karfreitags hallt in diesem Bildteil nach.
Über diesem Teil sehen wir die Stadt als schmalen Streifen. Es ist ein Bild im Bild, obwohl es offenkundig zur von der Fotografin vorgefun-denen Gliederung gehört, die das Fenster liefert, also authentischer Teil des Fotos ist. Für mich setzt sich damit der Schmerz des auf der unteren Ebene formulierten Geschehens fort. Auf mich wirkt diese Ebene wie ein Aufschrei. Die Häuser sind eingezwängt und eng. Mir drängte sich die Frage auf, ob Wohnungen nicht Ausdruck für die Tatsache sind, daß wir unentwegt nach der uns ursprünglich zuge-dachten Einwohnung in Gott suchen. Kompensation eines Verlustes, der mich letztlich dazu auffordert, jede Art der Kompensation zu überwinden, um endlich zu verstehen, wie das Leben schenkt und schenkt und nichts zurücknimmt.
Das Fenster, das dem Bild seine Gliederung gibt, ist offen.
Im dritten Teil des Fotos geht der Blick in einen blauen Himmel, wo sich die Kondensstreifen zweier Flugzeuge überschneiden und ein Kreuz bilden. Das Kreuz als zentrales Symbol christlicher Religion ist ein Zeichen am Himmel, das menschengemacht ist – und verschwinden wird. Darin liegt Trost und Verheißung zugleich, denn es wird ein neuer Himmel. Leipzig, Mai 2000
Sigûne und Gardevais

Das Bild entstand im Oktober ‘95 in einem Dorf des Pyrenäenvorlandes.
Der Ort und Handlung erscheinen einsichtig und überschaubar: ein Mädchen mit einem Hund in einer asphaltierten Gasse. Das barfüßige Mädchen wurde mitten in der Bewegung fotografiert; der Hund steht still und wirkt wie eine Attrappe. Die Farbe des Hundefells ähnelt der Farbe der Hauswände.
Die Szene erinnert ein bißchen an die Zirkusnummer eines Verwandlungskünstlers, etwas Surreales schwingt mit.
Das Mädchen trägt weiße Kleider, und offenkundig führt sie den Hund, dem sie ein Tuch umgehangen hat, nicht spazieren, sondern spielt mit ihm.
Mädchen und Hund sind im Mittelpunkt des Bildes, sind aber herausgehoben aus der stillen Atmosphäre der alten Häuser durch das extrem helle Sonnenlicht, das wie eine aus Licht geformte Gasse in der Gasse erscheint.
Der Betrachter nimmt Mädchen und Hund zunächst in diesem Flutlicht der Sonne war.
Die Handlung spielt auf dem Schnittpunkt zweier Gassen, die in der Bildmitte ein Kreuz bilden, wobei der vertikale Balken lichtvoll ist, der horizontale aber, gebrochen vom Licht, ein dunkler Schatten bleibt.
Bemerkt man den dünnen Strich, der das Bild in der Mitte von rechts nach links schneidet, wirkt die Figur des Mädchens wie bei einem Balanceakt auf dem Hochseil, zumal sie die Hundeleine wie eine Balancestock hält. Schaut man dann genauer hin, entdeckt man, daß sich die Füße des Mädchens vor dieser Linie befinden, während der Hund bewegungslos hinter dieser Linie steht. Die Linie ist also auch eine Trennungslinie zwischen Mädchen und Hund. Merkwürdigerweise wird diese Trennung aufgehoben im Schattenriß, der auf der Gasse zu sehen ist.
Das ist die Außenhaut des Bildes, wie der Betrachter es wahrnehmen kann. Ein Bild, das scheinbar nur vom atmosphärisch stillen Spiel in einer Gasse erzählt. Der Titel Sigûne und Gardevais deutet auf ein Bildgeschehen, das über das Sichtbare hinausführt.
Parallel zu diesen Aufnahmen entstand in St. Jean de Paracol das Gedicht „Wiedergeboren“, das dem Mädchen Anais gewidmet ist, das hier Modell spielte.
Gedicht und Fotografie beziehen sich auf die Geschichte in Eschenbachs „Parzival“, in der von Sigûne und Schoitnatulander berichtet wird, mehr aber noch auf „Titurel“, ein spätes Fragment Eschenbachs, in welchem er diese Episode aus dem „Parzival“ noch einmal aufnimmt, ausbaut und erklärt. „Der jüngere Titurel“ des historisch nicht gesicherten Albrecht von Scharffenberg muß hier nicht beachtet werden.
Sigûne ist die Tochter von Schoysiâne und Kyôt, der in die Gralsfamilie eingeheiratet hat und vermutlich mit „Willehalm“ identisch ist. Bei der Geburt der Tochter stirbt Schoysiâne, Sigûne wächst gemeinsam mit Condwîr âmûrs auf, die später Parzivals Frau wird.
Die Gralsfamilie im Epos Eschenbachs hier näher zu betrachten, würde zu weit führen, erwähnt sei nur: Schoysiâne ist die Schwester des wunden Gralskönigs Anfortas und des Einsiedlers Trevrizent. Und sie ist diejenige, die den Gral trägt.
Schoitnatulander ist der Waffengefährte von Parzivals Vater Gahmuret. Beide haben im Orient für die edle Dame Belacâne gekämpft, sie ist die Mutter von Parzivals Halbbruder Feirefîz.
Gahmuret ist in diesem Kampf ums Leben gekommen.
Schoitnatulander hat Sigûne zu seiner Dame erwählt. Sigûne verspricht ihm ihre Liebe, wenn er ihr den entlaufenen Hund Gardevais zurückbringt, in dessen kostbar gearbeitetes Brackenseil eine Schrift eingewoben ist, die sie bereits teilweise gelesen hat.
Gardevais heißt übersetzt „Achte auf den Weg“, der Hund erscheint so als Symbol für richtiges Verhalten.
Schoitnatulander nimmt die Prüfung an, eilt dem Hund nach und gerät dabei auf das Territorium des Fürsten Orilus, der ihn tötet.
Nicht nur der Hund ist Grund für den Zweikampf: Orilus hat dem jungen Parzival, der ohne Vater aufwächst, Länder geraubt, und Schoinatulander ist als ehemaliger Kampfgefährte Gahmurets natürlich dessen Sohn verpflichtet, zumal es ja Parzivals Cousine ist, die er liebt. Als Parzival Sigûne im Wald begegnet, erkennt sie ihn und sagt ihm nicht nur, wer er ist, sondern auch: „Zwei Länder hat dir Lähelîn genommen, diesen Ritter hier und deinen Vaterbruder erschlug Orilus in der Tjost“ (Drittes Buch, S.86).
Sigûne bezahlt einen hohen Preis für die Forderung, die sie an Schoitnatulander stellte: von
nun ab trauert sie um ihn, den Toten im Schoß, sitzend neben einer Quelle. Später baut man ihr an der Stelle eine Klause, und die Gralsbotin Cundrie versorgt die Einsiedlerin mit der Nahrung, die der Gral spendet. Im „Titurel“ berichtet Eschenbach weiter, daß nach Sigunes Tod aus den Mündern der Liebenden zwei Rebstöcke sprossen, die ineinander wuchsen.
Da Sigûne der Gralsfamilie angehört, und der Gral mit der Kraft des Wortes identifiziert wird, andererseits Schoinatulander zum Artuskreis zählt, der für die Kraft des Schwertes steht, kann man die Allegorie der ineinander wachsenden Rebstöcke als Verschmelzung von Wort und Schwert deuten.
Auslöser für die Tragödie ist der entlaufene Hund Gardevais und Sigûnes Wunsch, ihn bzw. die Hundeleine mit der eingearbeiteten Schrift zurückzubekommen. Es ist ihr wichtiger, die Schrift zu lesen - im „Titurel“ ist es ein Brief, mit dem Ekuhnat einen Brief an seine Frau schickt - als mit dem Mann zusammen zu sein, der sie liebt.
Am Ende hat Sigûne weder die Schrift noch den Geliebten, und das macht sie zu einer tragischen Figur: hätte sie den Hund samt Leitseil laufen gelassen, wäre das einem Liebesbeweis gleichgekommen. Ihre Unsicherheit, die sich im Verlangen nach der Schrift ausdrückt, wäre aufgegangen in der Fügung einer Gegenwart, der sie jedoch mißtraute.
So wird ihr die Prüfung, die sie Schoitnatulander auferlegt, zur Bestimmung.
Die junge Frau, die sich ihrer Schönheit bewußt ist, verliert ein Spiel, von dem sie wohl nicht ahnen konnte, daß es einen solch hohen Einsatz hat. Allerdings wird das, was sie verliert, zur Parabel auf den Verlust einer Liebe, die sich jedem Muster entzieht. Und die Schrift im Leitseil des Hundes ist ein Muster, das Sigûne unbedingt in die Hand bekommen will, von dem sie ihr Leben abhängig macht.
„Das Verlangen nach dem Brackenseil ist die Suche nach der eigenen Identität“, stellt Joachim Bumke fest (W.v.Eschenbach, Sammlung Metzler, S.282). Dies ist das Grundthema das Bildes: es zeigt ein Spiel auf der Mitte des Kreuzes, das durch einen hellen und einen dunklen Weg entsteht. Noch ist das Spiel nicht entschieden, Sigûne hat eine neue Chance erhalten.
17.-25.8.97